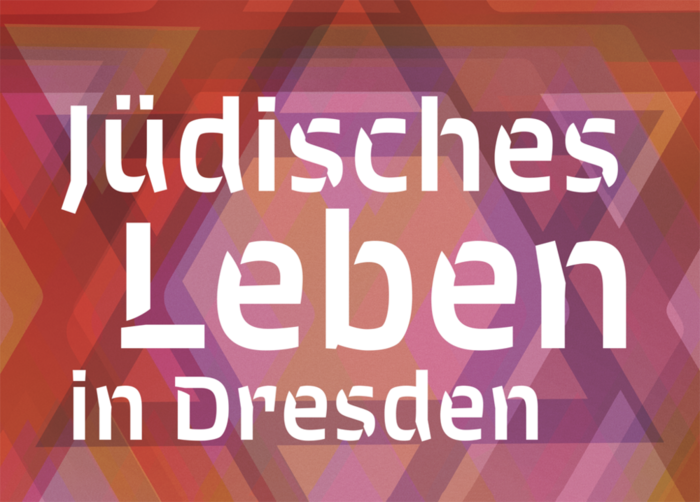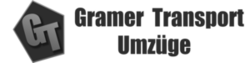|
Landeshauptstadt Dresden - www.dresden.de https://www.dresden.de/de/kultur/kunst-und-kultur/1700-Jahre-juedisches-Leben-in-Deutschland.php 26.01.2024 12:47:44 Uhr 27.07.2024 03:44:16 Uhr |
|
Jüdisches Leben in Deutschland
Menschen jüdischen Glaubens leben seit rund 1700 Jahren auf dem gebiet des heutigen Deutschlands. Auch die Landeshauptstadt Dresden widmet sich in enger Verbundenheit dem Jüdischen Leben in Deutschland.
Dabei richtet sich der Blick nicht ausschließlich auf die Vergangenheit sondern auch dem heutigen jüdischen Leben, seiner Vielfalt und Vitalität.
Revitalisierung und Kontextualisierung des Alten Leipziger Bahnhofs in Dresden-Neustadt
Ausschreibungsunterlagen
- Ausschreibung (*.pdf, 574 KB)
- Anlage | Handlungsempfehlung Jüdisches Gedenken (*.pdf, 11 MB)
- Anlage | Konzept Alter Leipziger Bahnhof Verkehrsmuseum (*.pdf, 9 MB)
- Anlage | Machbarkeitsstudie Alter Leipziger Bahnhof SachsenEnergie (*.pdf, 2 MB)
Ausschreibung zur Erstellung eines Nutzungs- und Betreibungskonzeptes für ein Jüdisches Bildungs-, Vermittlungs- und kulturelles Begegnungszentrum
Der Alte Leipziger Bahnhof in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof Dresden-Neustadt nimmt einen wichtigen Platz innerhalb der Dresdner Erinnerungskultur ein. Vom 21. Januar 1942 bis ins Jahr 1944 diente er als Ausgangspunkt und Zwischenstation von Deportationen der jüdischen Bevölkerung und zunehmend auch weiterer Opfergruppen in die Ghettos und Vernichtungslager der Nationalsozialisten. Als Gedenkort gewinnt er in der Aufarbeitung der Rolle Dresdens während der NS-Zeit eine immer größere Bedeutung. Zudem verfügt der Alte Leipziger Bahnhof über ein markantes industriehistorisches Erbe. Als Endstation der ersten deutschen Ferneisenbahnverbindung 1839 zwischen Leipzig und Dresden soll er als bedeutender Ort sächsischer Industriegeschichte im Sinne eines mobilitätsgeschichtlichen Erfahrungs- und Erinnerungsraumes verankert werden.
Mit dem Beschluss des Dresdner Stadtrates, auf dem Gelände des Alten Leipziger Bahnhofs einen Gedenkort mit einem Jüdischen Bildungs-, Vermittlungs- und kulturellen Begegnungszentrum zu errichten, kommt dem Areal eine exemplarische Funktion in der kommunalen Geschichtsaufarbeitung und Erinnerungskultur zu.
Die Landeshauptstadt Dresden ruft daher Verbände, Initiativen, Institutionen und Arbeitsgemeinschaften auf, für ein Jüdisches Bildungs-, Vermittlungs- und kulturelles Begegnungszentrum am Alten Leipziger Bahnhof ein Nutzungs- und Betreibungskonzept zu erstellen.
Die Erarbeitung eines Nutzungs- und Betreibungskonzeptes wird gemäß der Ausschreibung mit einer Aufwandsentschädigung von 2.500 EUR pro Angebot bei fristgerechter und vollständiger Einreichung der geforderten Unterlagen vergütet. Insgesamt hat der Dresdner Stadtrat für den Prozess der Erarbeitung eines Nutzungs- und Betreibungskonzeptes 100.000 EUR für das Haushaltsjahr 2024 bereitgestellt.
Das einzureichende Nutzungs- und Betreibungskonzept erfolgt auf Grundlage der Ausschreibung, die den Rahmen für das anzustrebende Profil eines Jüdischen Bildungs-, Vermittlungs- und kulturellen Begegnungszentrum auf dem Gelände des Alten Leipziger Bahnhofs absteckt. Mit der Konzepterarbeitung soll zugleich ein Vorschlag eingereicht werden, welche Initiative, Institution o. ä. das Jüdische Bildungs-, Vermittlungs- und kulturelle Begegnungszentrum betreiben soll oder für diese aufgrund entsprechender Erfahrungen und Kompetenzen in Frage kommt.
Wünschenswert ist das Interesse von interdisziplinär aufgestellten Initiativen, Vereinen und Einrichtungen auf lokaler, regionaler oder nationaler Ebene aus dem Spektrum Kultur, historisch-politischer Bildung bzw. Vermittlung und Demokratieförderung. Die Entscheidung über die Vergabe des Auftrages zur Erstellung des Nutzungs- und Betreibungskonzeptes für das Jüdische Bildungs-, Vermittlungs- und kulturelle Begegnungszentrum trifft die durch den Dresdner Stadtrat eingesetzte Steuerungsgruppe Alter Leipziger Bahnhof.
Interessierte Bieter sind aufgefordert, ihr Gebot bis zum 8. April 2024, 23.59 Uhr im Amt für Kultur und Denkmalschutz per E-Mail unter kultur-denkmalschutz@dresden.de einzureichen.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Herrn André Podschun (Tel.: 0351-4888927, E-Mail: apodschun@dresden.de).