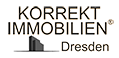|
Landeshauptstadt Dresden - www.dresden.de https://www.dresden.de/de/kultur/kulturentwicklung/kulturentwicklungsplan.php 15.11.2023 14:54:10 Uhr 31.01.2026 06:30:06 Uhr |
|
Kulturentwicklungsplan
Visionen, Ziele und konkrete Vorhaben für die Dresdner Kultur
Ende 2020 hat der Stadtrat den neuen Kulturentwicklungsplan (KEP) für die Landeshauptstadt Dresden beschlossen. Vorausgegangen war dem eine vierjährige Zeit der Planung, von umfänglichen Recherchen, Textarbeit, einer breiten Beteiligung von Fachleuten und der Bürgerschaft. So waren bei einer Vielzahl von Fachtagen und Expertengremien nicht nur fachliche Expertise gefragt, sondern auf Bürgerforen in sämtlichen Stadtbezirken und bei einer weithin wahrgenommenen Online-Bürgerbeteiligung insbesondere die Vorschläge der Dresdnerinnen und Dresdner.
Im Ergebnis entstand ein mehr als hundertseitiges Planungsdokument. Es beschreibt für einen zeitlichen Horizont von rund zehn Jahren Visionen, Ziele und konkrete Vorhaben für die Dresdner Kultur. Ausgangspunkt sind die Herausforderungen, vor denen Dresden und seine Kulturakteure stehen. Dazu gehören der demografische und der Gesellschaftswandel, die fortschreitende Digitalisierung vieler Lebens- und Kulturbereiche und die Wende hin zu mehr Nachhaltigkeit.
Dabei stehen die Strategien, mit dem Wandel umzugehen, im Mittelpunkt. Deshalb wurden dem KEP fünf Leitlinien vorangestellt. Gesellschaftswandel gestalten, die erste Leitlinie, fokussiert darauf, vermittels Kultur der Aufspaltung der Stadtgesellschaft in immer mehr Parallelwelten entgegenzuwirken. Wichtige Stichwort sind gesellschaftlicher Zusammenhalt, Geschlechter- und Altersgerechtigkeit, Diversität, interkulturelle Verständigung und Inklusion. In der zweiten Leitlinie – zum Gedächtnis der Stadt – steht die Auseinandersetzung mit dem für Dresden wichtigen Selbstverständnis im Vordergrund. Bei der dritten – zu Gegenwart und Zukunft in Kunst und Kultur – die Vision einer ambitionierten, lebendigen Szenerie zeitgenössischer Künste, die in engen Bezügen zu wegweisenden europäischen und internationalen Entwicklungen steht. Die vierte Leitlinie ist um Qualität und Exzellenz als übergreifendem Maßstab für die Künste zentriert und die fünfte um Kulturelle Bildung und Teilhabe für alle. Teilhabe meint dabei, vom Vorschul- bis ins Rentenalter allen nicht nur die Beteiligung an Kunst und Kultur zu eröffnen, sondern auch die „Werkzeuge“ dafür in die Hand zu geben, sich in Stadt und Gesellschaft mit eigenen Ideen einbringen zu können.
Konkrete Ziele und Vorhaben werden dann im nach Kunst- und Kultursparten gegliederten Abschnitt aufgelistet.
Wichtige sind:
- eine faire Honorierung für Kunst- und Kulturschaffende der freien Szenen durchzusetzen
- angesichts der Knappheit neue Räume für Kunst und Kultur eröffnen (Atelierräume und - häuser, Villa Wigman als Produktionszentrum für die freie darstellende Szene etc.)
- Kultur- und Nachbarschaftszentren in Stadtteilen einrichten
- den Investitionsstau in der kulturellen Infrastruktur auflösen
- Aufbau einer digitalen Plattform für Literatur
- zeitgemäße Formatentwicklung unter besonderer Berücksichtigung unterrepräsentierter Gruppen in der Musik sowie Stärkung von Freier Szene und Clubkultur
- neue Plattformen für die Medienkunst schaffen und kulturelle Infrastruktur dafür stärken
- Urban Art vermittels eines eigenen Konzeptes unterstützen
- ein Interkulturelles Zentrum im Kraftwerk Mitte errichten
- das Lapidarium als Depot städtischen Gedächtnisses auszubauen
Download
- Kulturentwicklungsplan (Langfassung) (*.pdf, 3 MB)
- Kulturentwicklungsplan (Kurzfassung) (*.pdf, 1 MB)
- Kulturentwicklungsplan (Kurzfassung leichte Sprache) (*.pdf, 1 MB)
Konzeption zur Unterstützung und Förderung von UrbanArt in Dresden
Die Gesamtkonzeption betrachtet Bedarfe und Angebote dieser zeitgenössischen Kunst und Jugendkultur differenziert und verbindet kulturelle und präventive Belange.
Zur Entwicklung der Konzeption war zunächst eine verwaltungsinterne Arbeitsgruppe gebildet worden. Sie stellte ein Eckpunktepapier für die Konzeptentwicklung auf. Darauf wurde die Arbeitsgruppe um sechs Vertreter und Vertreterinnen von für Dresden wichtigen UrbanArt-Szenen sowie um Akteure erweitert, die in der relevanten Kultur- und Jugendarbeit aktiv sind. Mit ihnen wurde das Eckpunktepapier ausführlich diskutiert und maßgeblich erweitert.