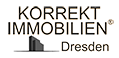|
Landeshauptstadt Dresden - www.dresden.de https://www.dresden.de/de/leben/stadtportrait/geschichte.php 20.11.2025 14:56:04 Uhr 09.01.2026 05:13:28 Uhr |
|
Stadtgeschichte
Gegründet am Ort eines slawischen Fischerdorfs als Kaufmannssiedlung und landesherrliche Burg, war Dresden seit dem 15. Jahrhundert Residenz der sächsischen Herzöge, Kurfürsten und später Könige.
Die Stadt erlebte glanzvolle wie tragische Zeiten, sie war vor allem im 18. Jahrhundert ein prächtiges Zentrum europäischer Politik, Kultur und Wirtschaft und wurde nur zwei Jahrhunderte später zum Synonym für apokalyptische Zerstörung.
Den Dresdnern und den Freunden in aller Welt war und ist Dresden heute noch ein einzigartiger Ort, dessen Faszination sich auch auf eine reiche Geschichte gründet.