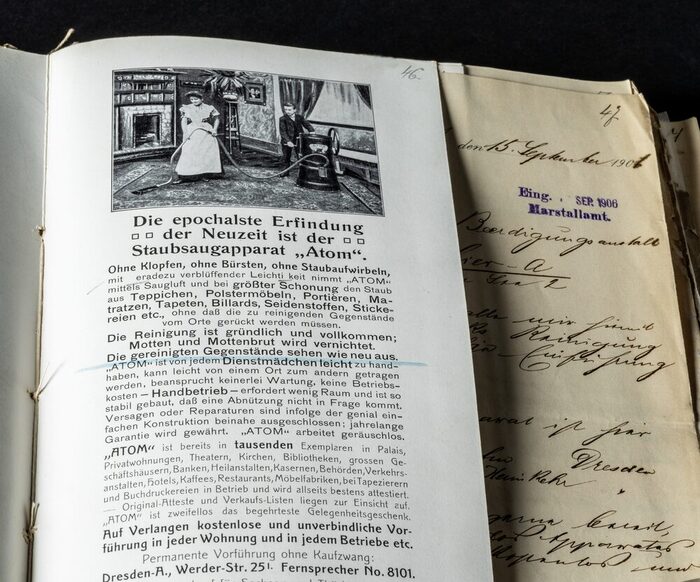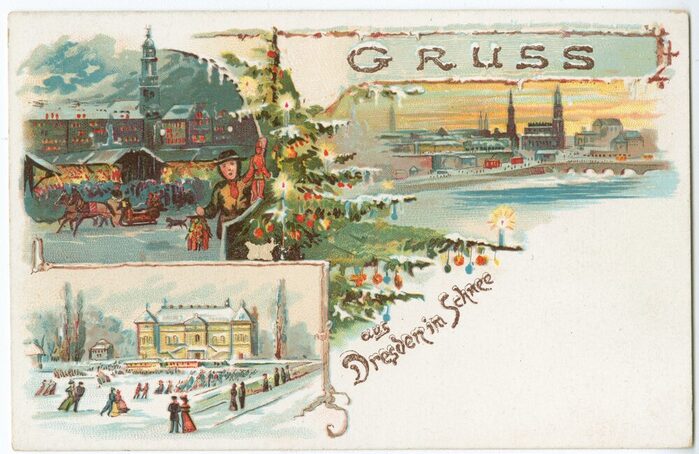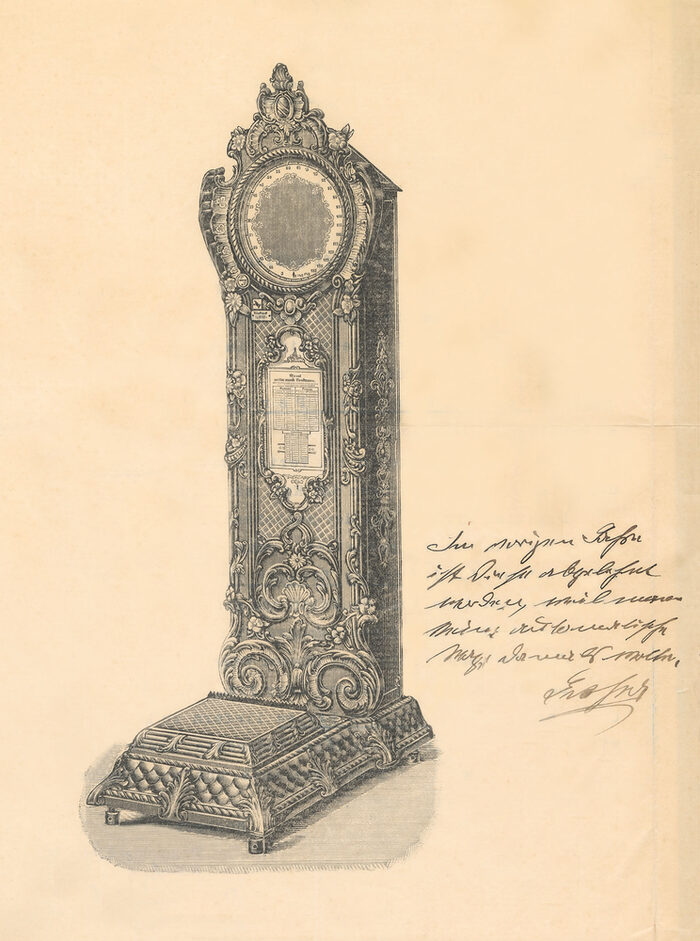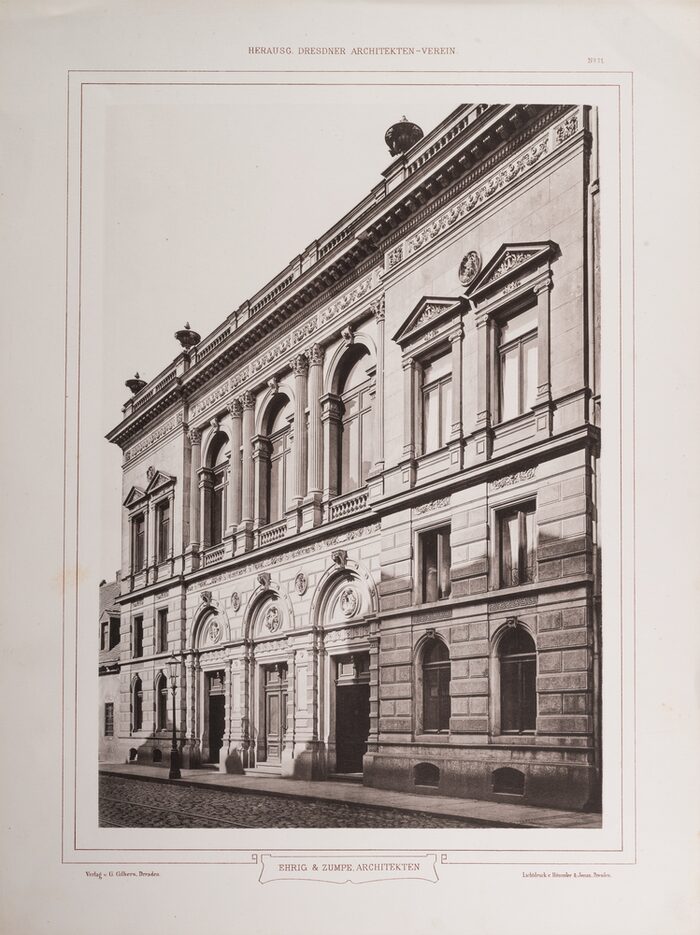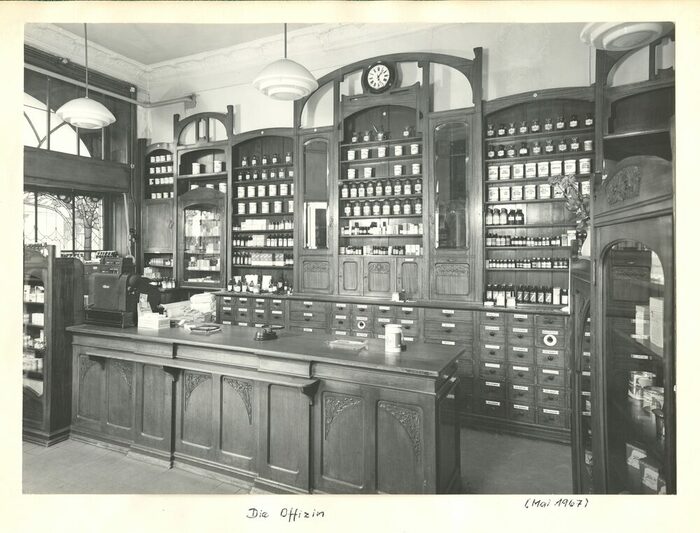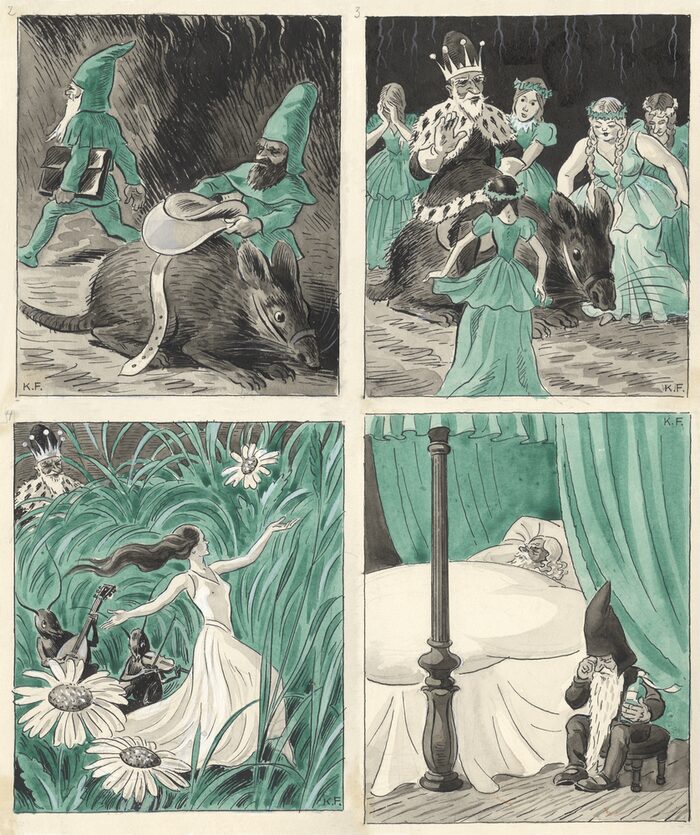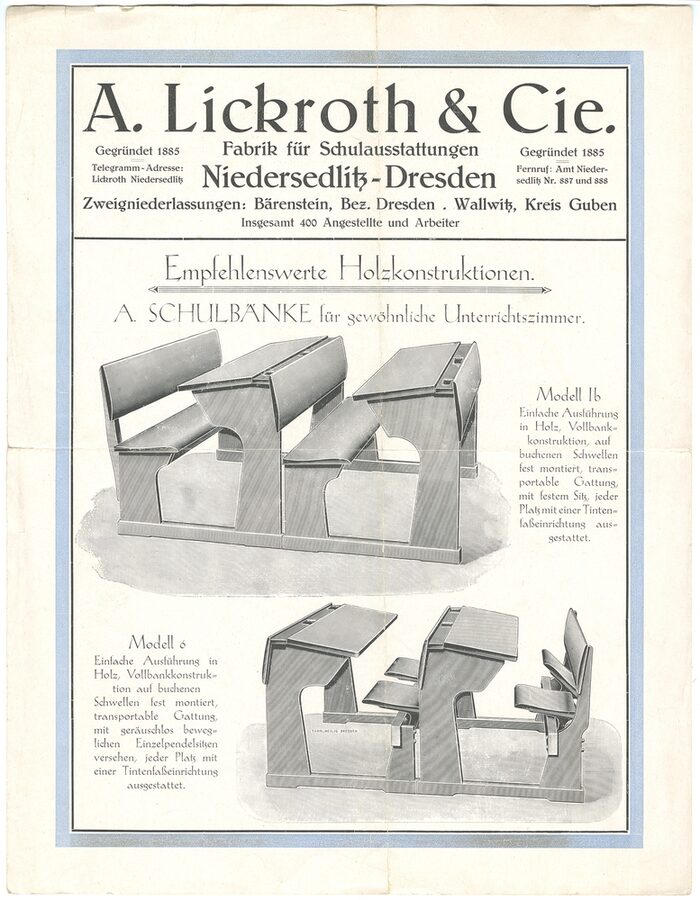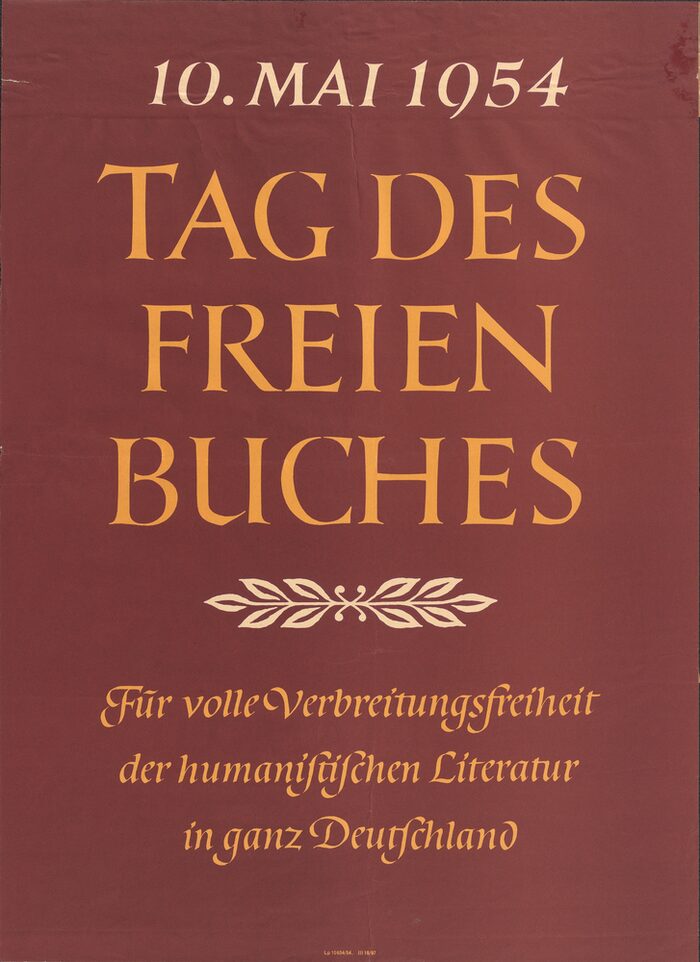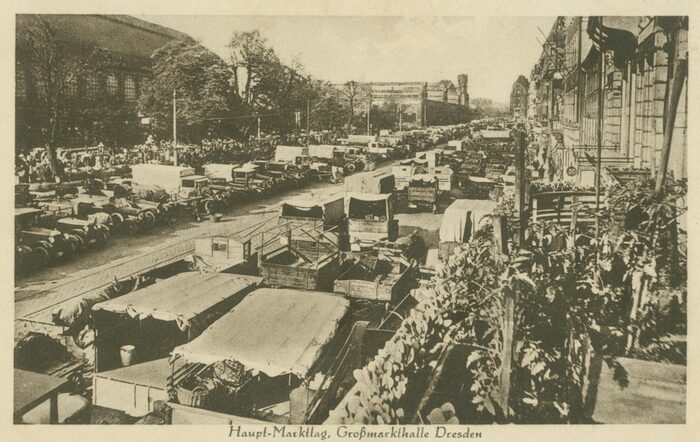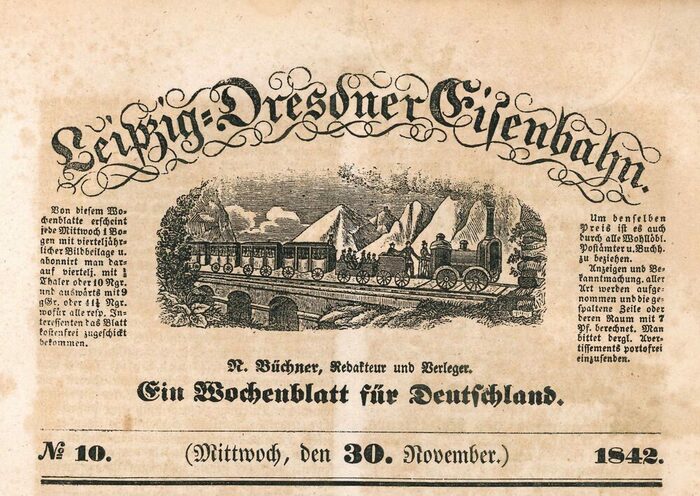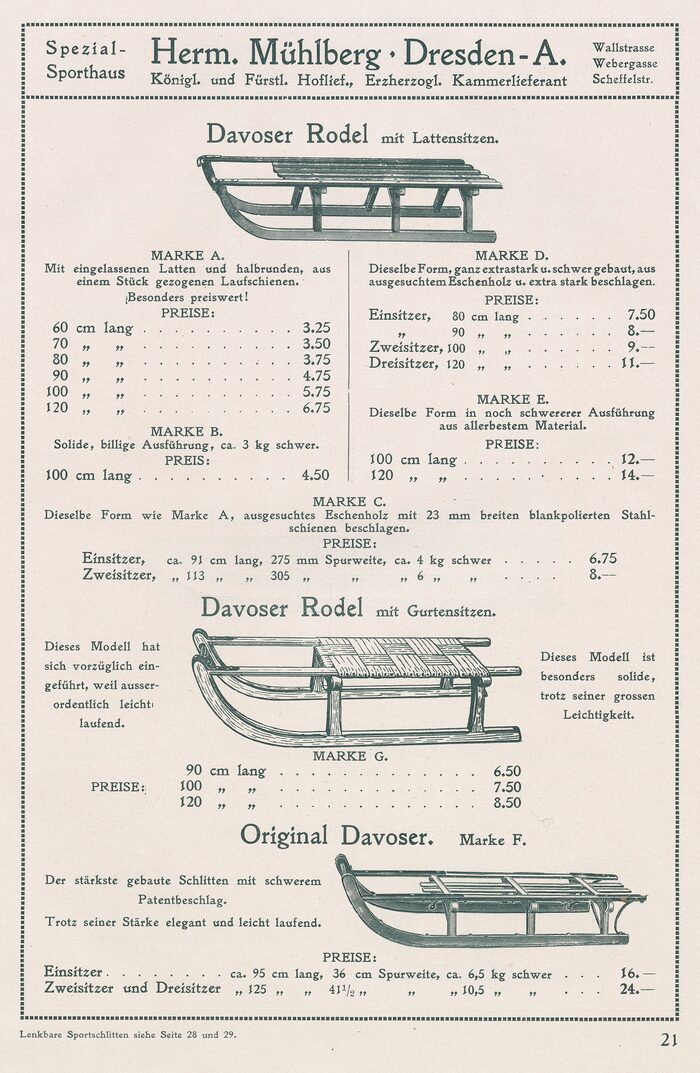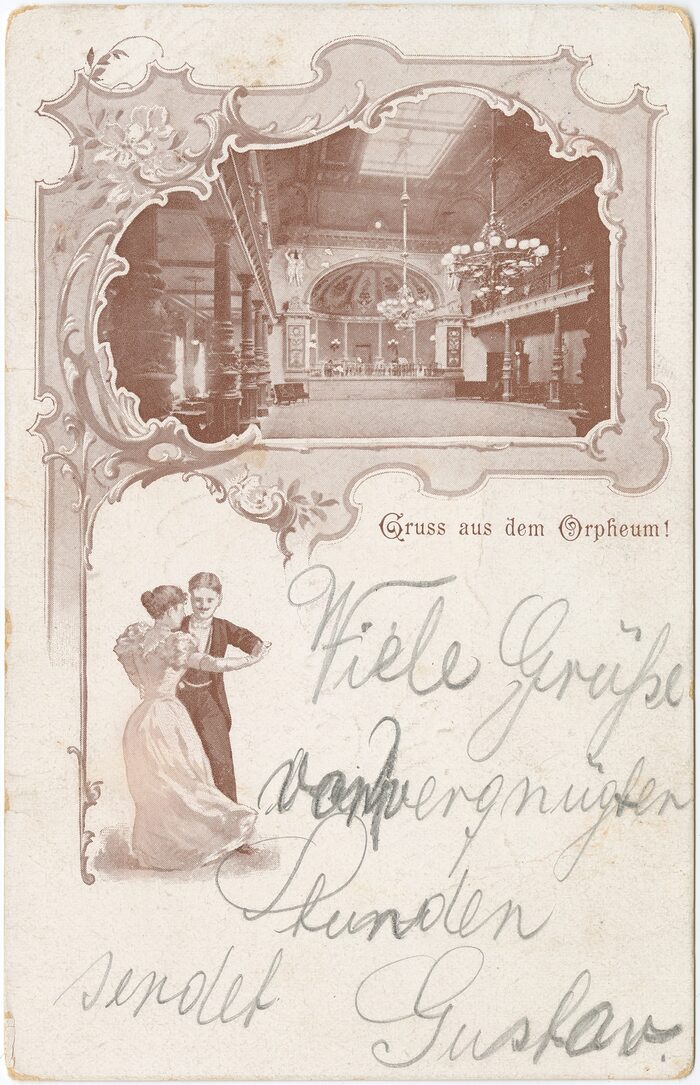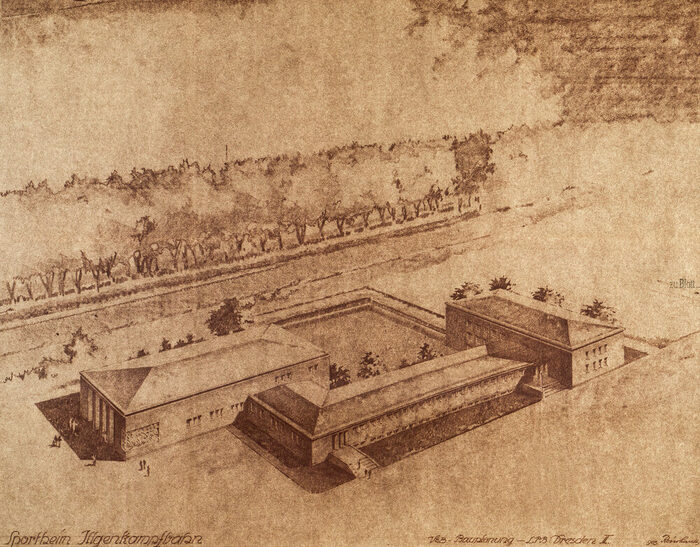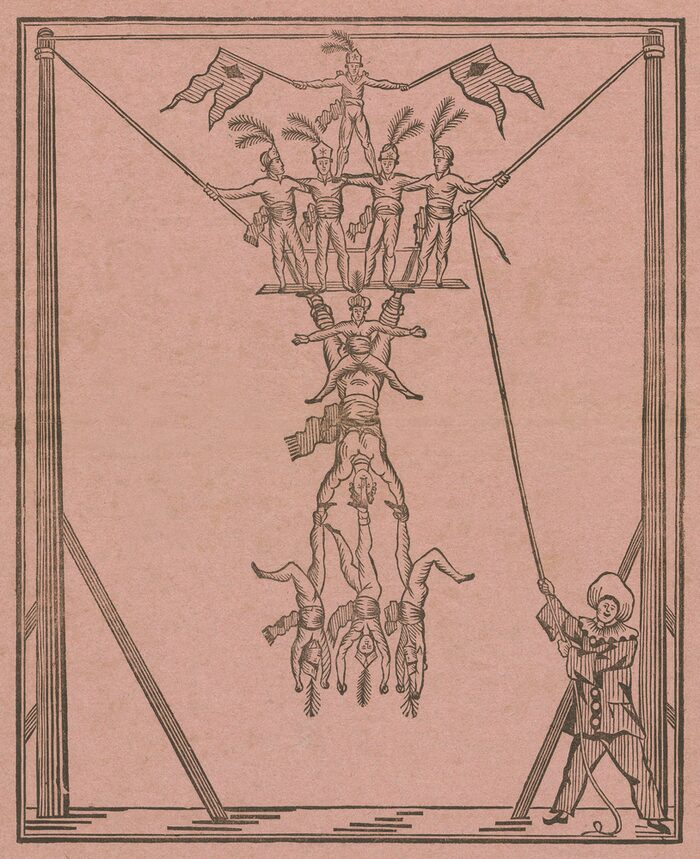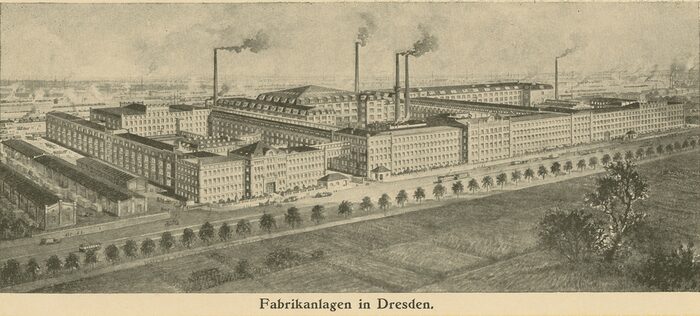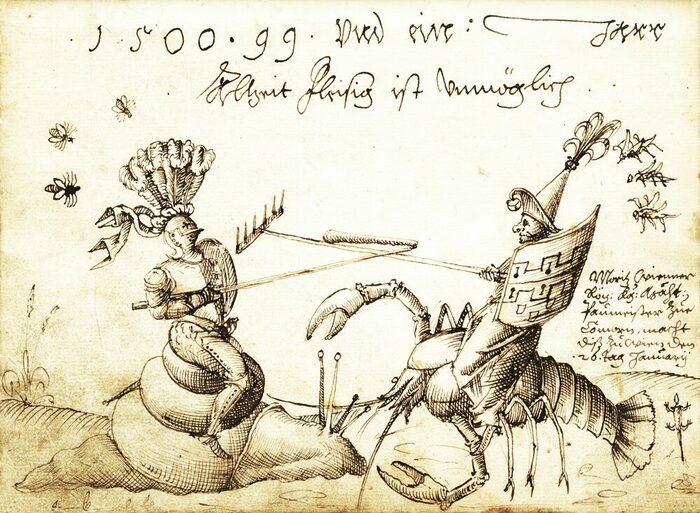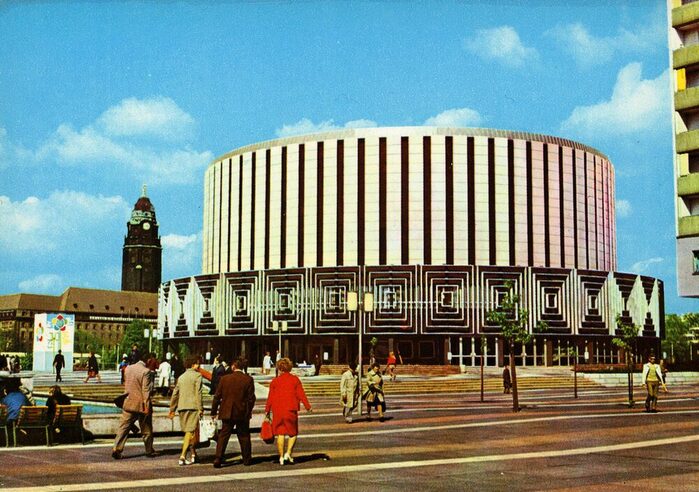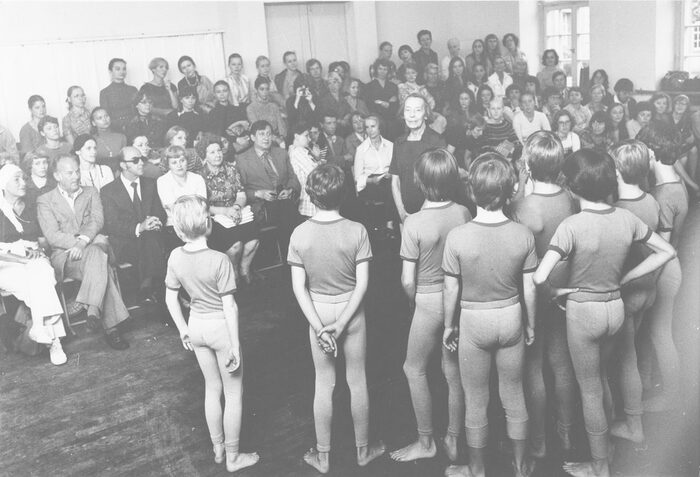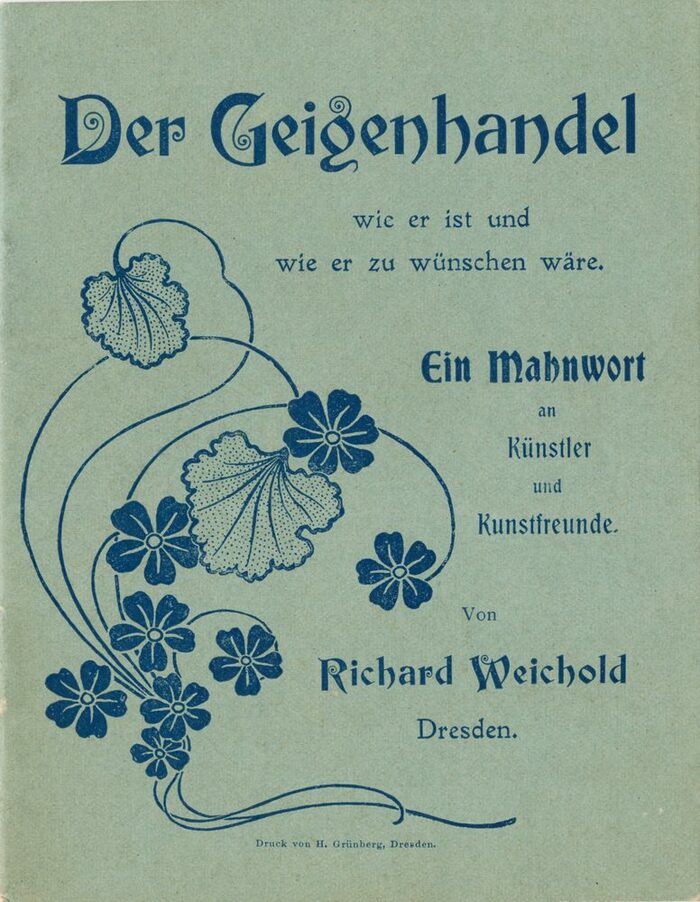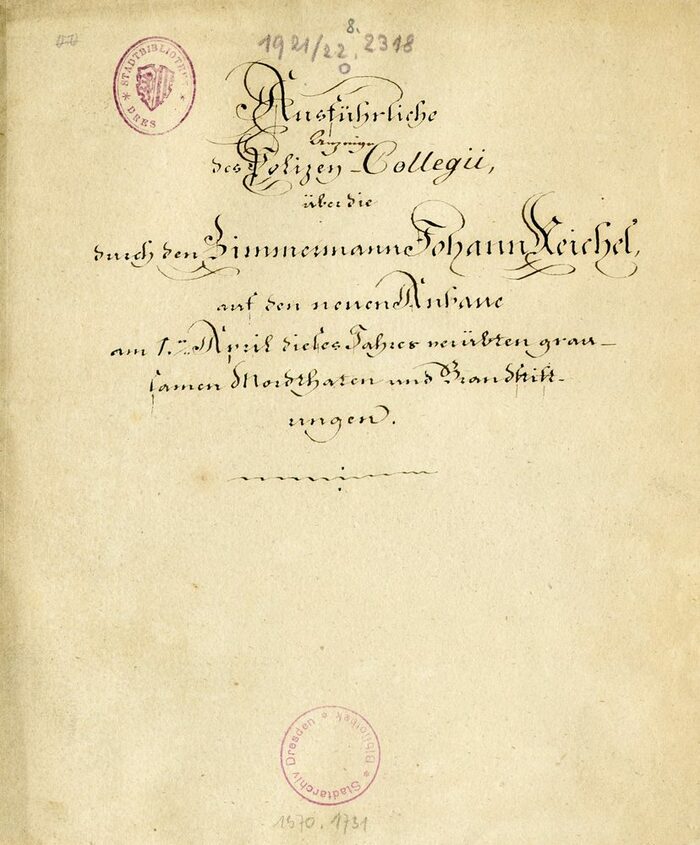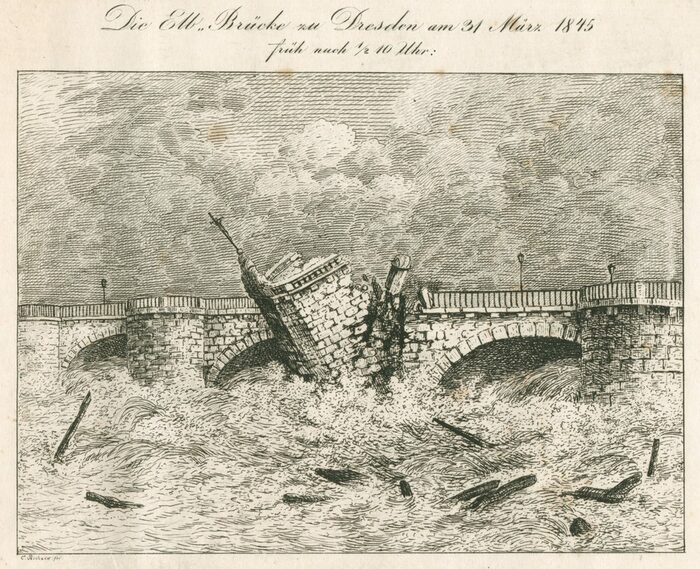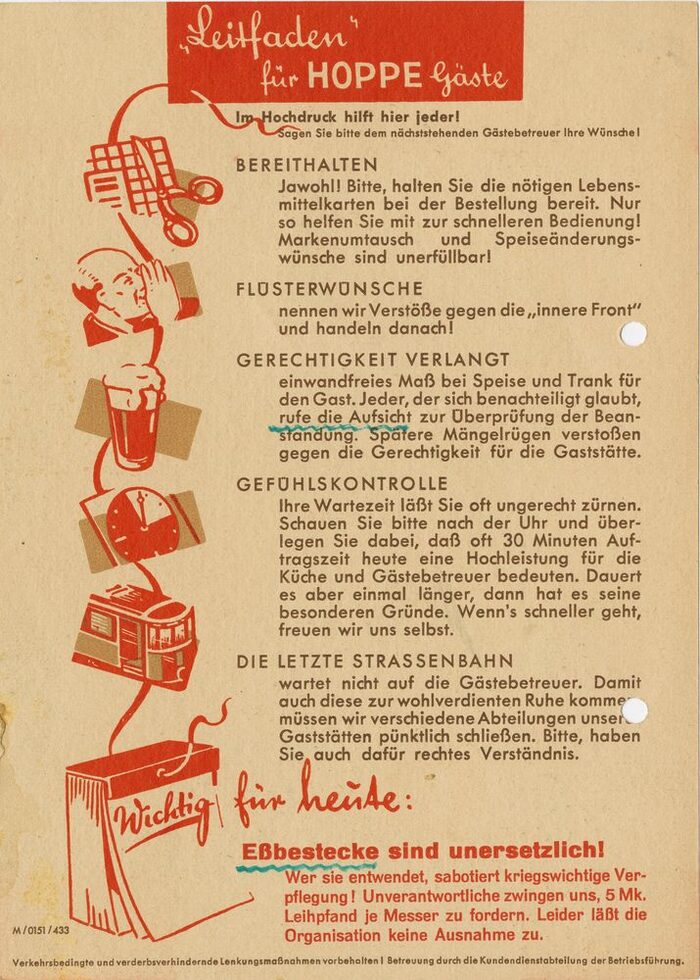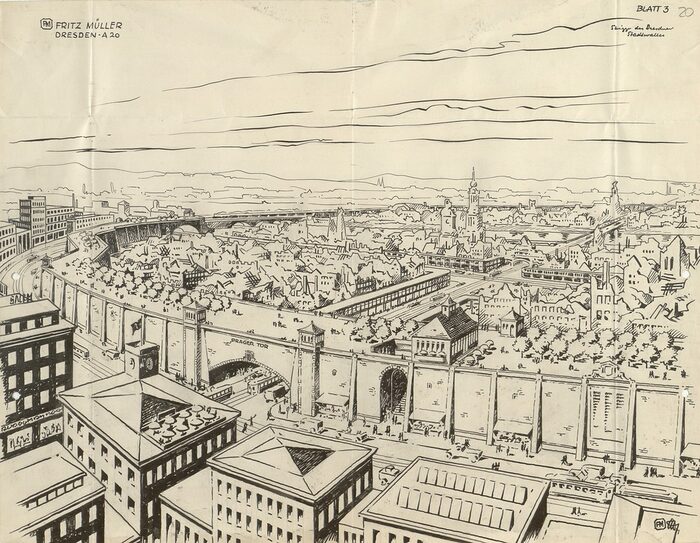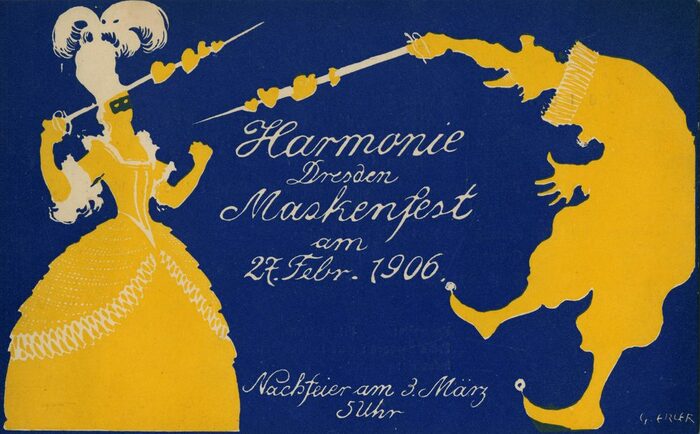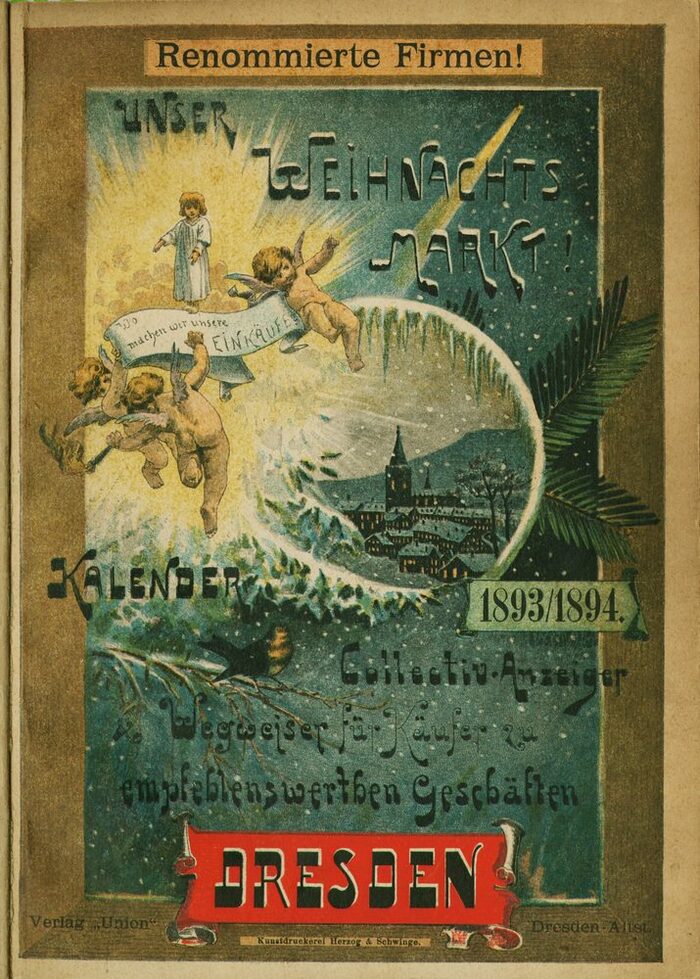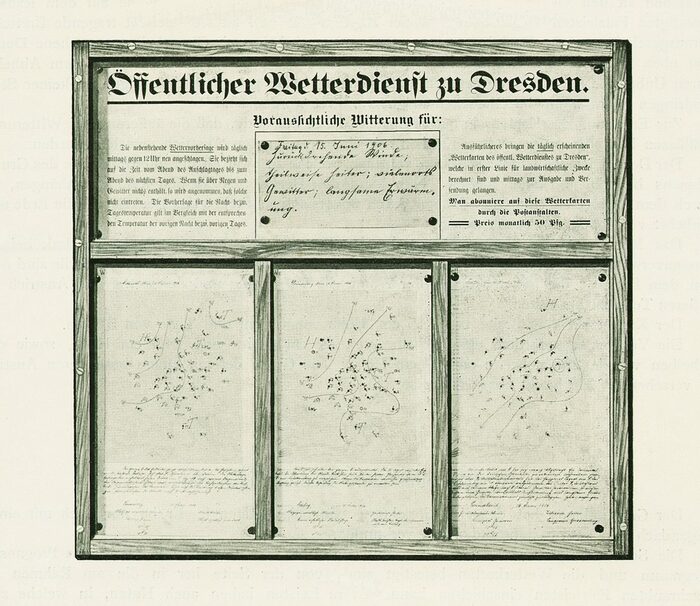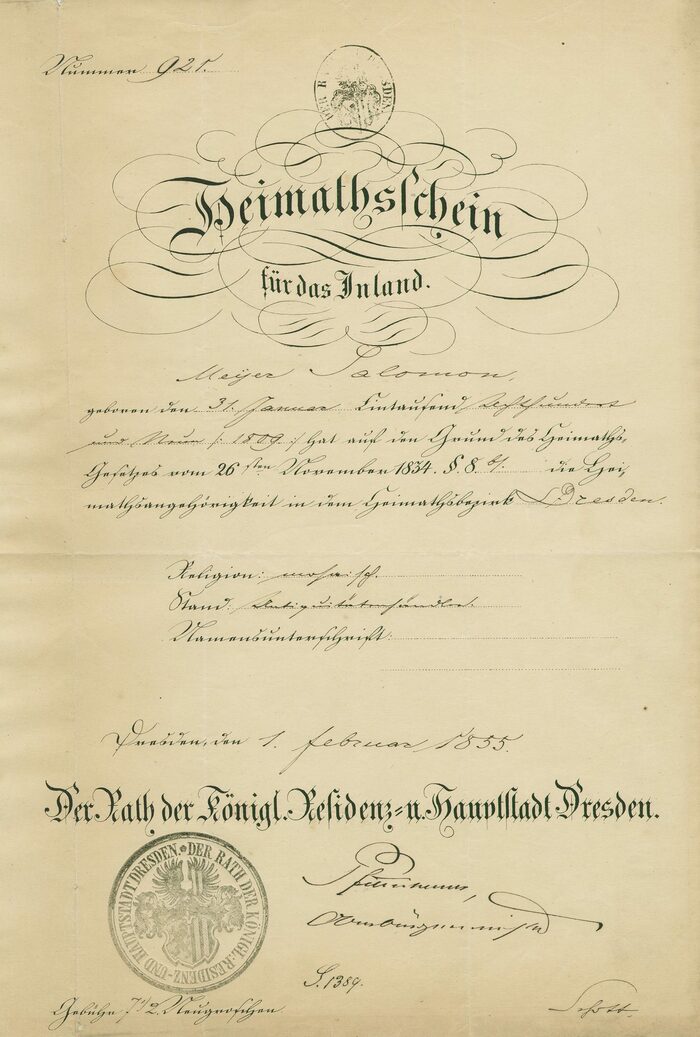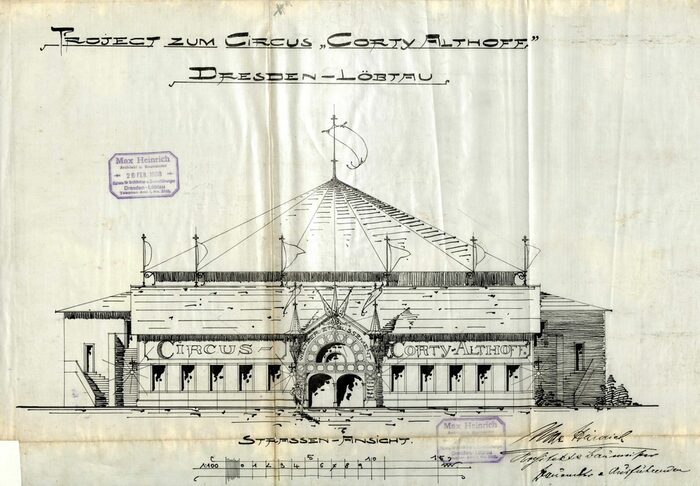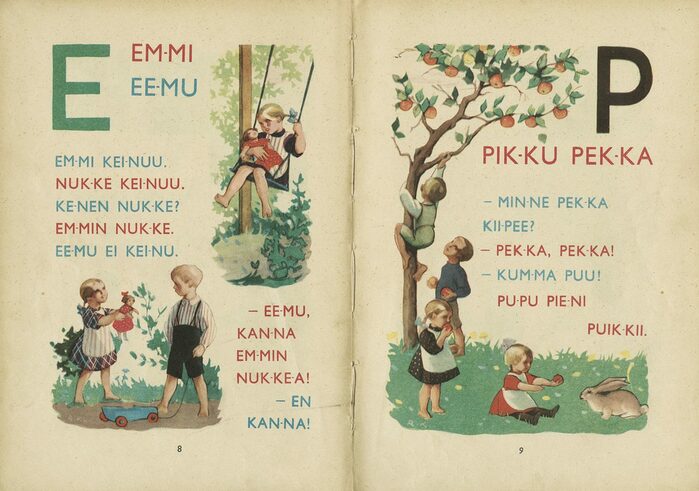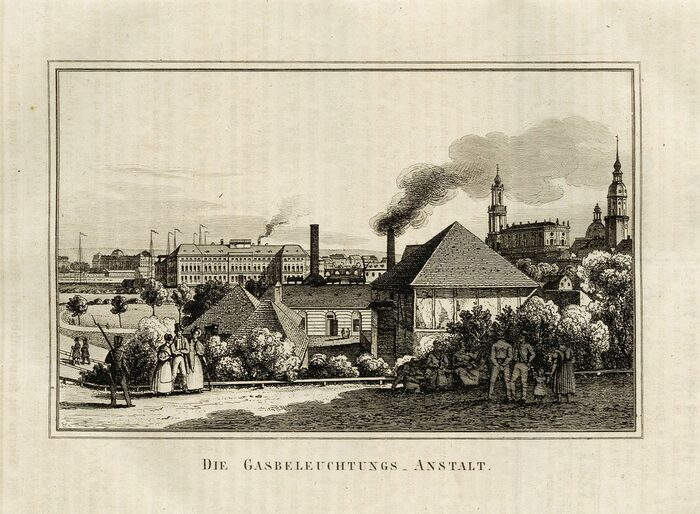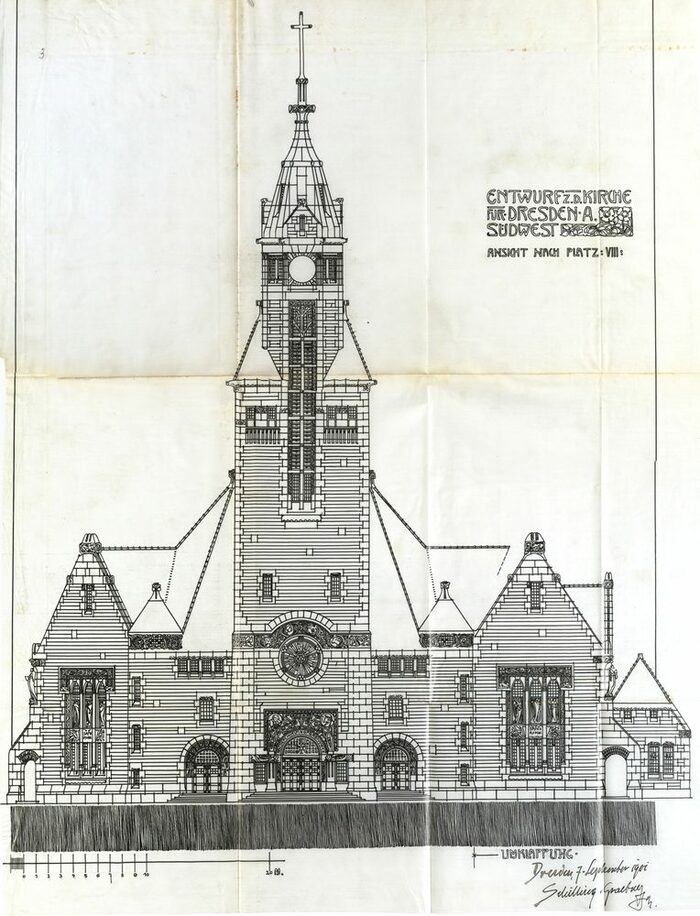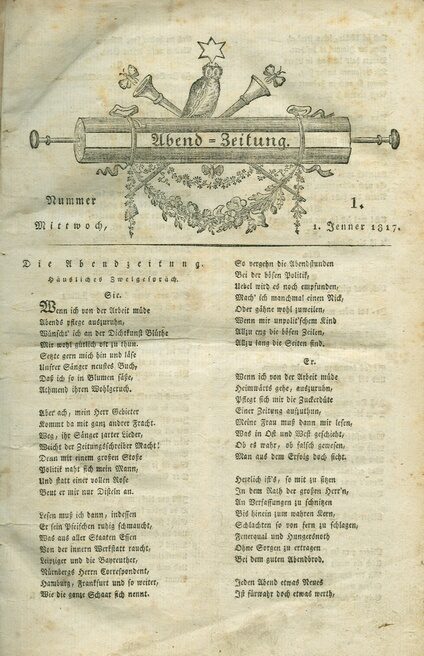|
Landeshauptstadt Dresden - www.dresden.de https://www.dresden.de/de/rathaus/aemter-und-einrichtungen/unternehmen/stadtarchiv/archivalien-des-monats.php 07.01.2026 14:55:08 Uhr 01.02.2026 14:31:55 Uhr |
|
Archivalien des Monats
Januar 2026
»Die epochalste Erfindung der Neuzeit« erhält Einzug in die Stadtverwaltung. Der Staubsaugapparat ›Atom‹ von Edmund Kussi
Für viele Menschen beginnt das neue Jahr nach Weihnachten und Silvester mit einem großen Bodenschwung. Als gründlicher und schneller Helfer gilt dabei der Staubsauer. Nach über einem Jahrhundert Entwicklungsarbeit sind die Geräte heute handlich, leicht und schnurlos oder kommen gar als Roboter daher. Warum der Staubsaugapparat bereits zur Zeit seiner Erfindung als epochalste Erfindung galt, erfahren Sie in unserer Archivale des Monats.
Im Oktober 1906 wandte sich der in Dresden ansässige Geschäftsmann Edmund Kussi (1866–1935) mit verschiedenen Broschüren zum Staubsaugapparat „Atom“ an das Marstall- und Bestattungsamt der Stadt Dresden. Der nahe Pilsen geborene Kussi war 1906 mit seiner Familie nach Dresden gezogen und wurde in den Adressbüchern als „Alleinvertrieb des Staubsaugapparates ›Atom‹ für Sachsen und Thüringen“ geführt. Eigentlicher Hersteller war der Österreicher Gustav Robert Paalen (1873-1945). Bereits kurz nach der Jahrhundertwende hatte Paalen US-Patente für die Staubsaugerapparate „Santo“ und „Atom“ erworben und diese erfolgreich weiterentwickelt. Erster Einsatzort war unter anderem die Wiener Hofburg. Dieser elitäre Kunde öffnete auch andernorts die Türen, wie der Vertriebler Kussi in seiner Werbebroschüre zum Staubsaugapparat „Atom“.
Sein Ziel war es, den Verkauf des Produktes zu befördern, indem er den Mehrwert des Apparates für die Reinigung der städtischen Bestattungswagen und Kutschen bewarb. Der ›Atom‹ war dabei keineswegs neu in der Stadtverwaltung, sondern kam bereits bei der Reinigung der Straßenbahn zum Einsatz. Obwohl die Anschaffung eines weiteren Apparates durch das Amt abgelehnt wurde, verweisen die überlieferten Werbebroschüren auf ein breites Spektrum zufriedener Kunden aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen, angefangen bei der Hofhaltung des sächsischen Königshauses bis hin zu Privathaushalten, Fabriken, Geschäftshäusern, Sanatorien, Hotels und Kaffeehäusern.
Eine persönliche Vorführung dieser „epochalste(n) Erfindung der Neuzeit“, wie Kussi den Staubsauger in den Werbetexten nannte, bot er täglich in seinem Geschäft in der Seestraße 18 an und erklärte ausführlich die Funktionsweise wie auch den Mehrwert des Gerätes. Dieser lag nicht ausschließlich in der gründlichen Reinigung der Teppiche, Bodenbelege und Wandvorhänge, sondern erwies der Gesellschaft hinsichtlich der Hygiene wertvolle Dienste. Dank neuer Technik konnte auf das bis dahin gebräuchliche Teppich ausklopfen, das Schmutz und Keime in die Luft und in die Atemwege des Reinigungspersonals verbrachte, verzichtet werden.
Die Broschüre des Staubsaugapparates ›Atom‹ ist beispielhaft für die Konsumkultur des täglichen Lebens im industriellen Deutschen Kaiserreich zur Jahrhundertwende. Logo und Design der Produkte folgten der damals aktuellen Mode des Jugendstils und durch den Verweis auf errungene Auszeichnungen im Rahmen von Hygiene- und Fortschrittsausstellungen wurden die Kunden zum Kauf angeregt. Auf diese Weise Begann der Siegeszug des Staubsaugers in die europäischen und amerikanischen Haushalte und eroberte bald darauf die ganze Welt.
Dr. Sylvia Drebinger-Pieper
Quelle: Stadtarchiv Dresden, 9.1.13 Marstall- und Bestattungsamt, Nr. 50, Bl. 46a
Archivalien des Monats aus dem Jahr 2025
Dezember 2025
Weihnachtszeit – schöne und harmonische Zeit?
Wenn am Mittwoch vor dem ersten Advent der Dresdner Striezelmarkt eröffnet wird, dann beginnt die Zeit des Beschaulichen und Besinnlichen. Vor allem die Weihnachtsgrüße werden mit romantisierenden Abbildungen geschmückt. Bei der Archivalie des Monats Dezembers handelt es sich um eine solche historische Postkarte, die das weihnachtliche Dresden, insbesondere das gesellige Treiben auf dem Altmarkt veranschaulicht. Dass sich insbesondere zwischen den zahlreichen Händlern ein ganz anderes Bild ergab, berichtet eine Akte des Ratsarchivs.
Am 13. Dezember 1816 trat die Dresdner Drechsler-Innung mit der Bitte an den Stadtrat heran, einem gewissen Carl Gottlob Jahn zu untersagen, seine Stände auf dem Striezelmarkt aufzubauen. Die Drechsler kritisierten, dass Jahn mit Produkten handelte, die eigentlich der Drechsler-Innung vorbehalten waren und dem Meisterzwang unterlagen. Er hätte das Drechslerhandwerk nie erlernt. Des Weiteren geriet es ihm zum Vorwurf, dass er zusammen mit seiner Frau an zwei Buden verkaufte, was laut Marktordnung verboten war. Aus diesem Grund forderten die Drechsler von der Stadt, dass Jahn vom Striezelmarkt verwiesen und seine Ware beschlagnahmt werde.
Jahn war kein Händler aus dem Erzgebirge, sondern wohnte in Dresden vor dem Pirnaischen Tor. Er hatte bis zum Jahr 1814 in der sächsischen Armee gedient. Im Anschluss an seine Zeit als Soldat begann er einen Handel mit Galanteriewaren. Er kam auf die Idee, Holzwaren und Spielzeuge bei den Herstellern im Erzgebirge einzukaufen und diese dann mit einem Aufschlag auf den Dresdner Märkten anzubieten. Jahn gab dem Stadtrat gegenüber zu, mit Hilfe seiner Frau auf dem Striezelmarkt Spielsachen und andere Holzprodukte in zwei Buden zu verkaufen. Als verabschiedeter Soldat mit Freischein berief er auf die Militärverfassung des Königreichs Sachsen. Laut dieser Bestimmung konnten Soldaten nach achtjähriger Dienstzeit oder bei Invalidität eine Kunst, ein Handwerk oder ein Gewerbe treiben, auch wenn sie das Meisterrecht nicht erlangt haben. Diese Regelung verhinderte, dass die Soldaten nach ihrer offiziellen Verabschiedung in die Bedürftigkeit abrutschten.
Im Januar 1817 erfolgte die Abweisung der Beschwerde der Drechsler. August I. befahl der Stadt, dass der Handel von Carl Gottlob Jahn auf dem Striezelmarkt nicht zu behindern sei. Somit stand in den nachfolgenden Jahrhunderten dem Siegeszug von Räuchermännel, Nussknacker und Schwibbogen nichts mehr im Weg. Die Frage, wie das heutige Warenangebot des Striezelmarkts aussehen würde, wäre damals im Sinne der Drechsler-Innung entschieden wurden, bleibt damit für immer unbeantwortet.
Dr. Marco Iwanzeck
Quelle: Stadtarchiv Dresden, 17.6.1 Ansichtskartensammlung, Nr. GA 408
November 2025
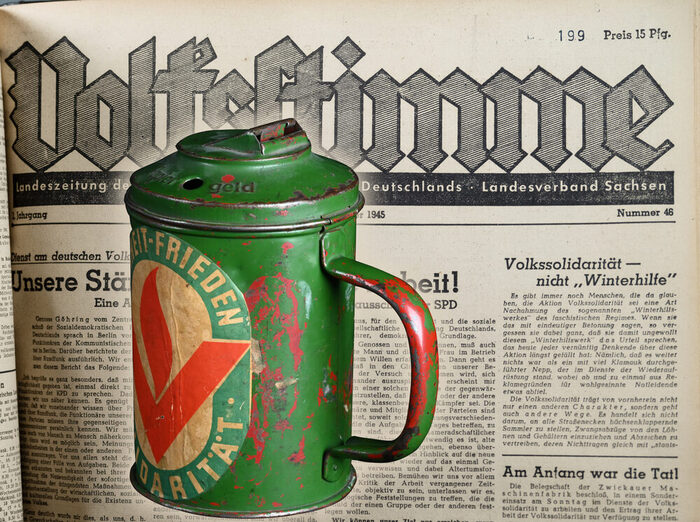
Von der Winternothilfe zur Volkssolidarität
„Volkssolidarität – nicht ‚Winterhilfe‘“ titelte die Landeszeitung der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands „Volksstimme“ am 4. November 1945, unserer aktuellen Archivale des Monats. Wenige Wochen nachdem die Volkssolidarität am 17. Oktober 1945 erstmals öffentlich in Erscheinung getreten war, gingen die Organisatoren auf Distanz zu ihrem anfänglich gewählten Aufruf „Volkssolidarität gegen Winternot!“. Ursache dafür war der kritische Umgang mit dem Begriff der Winternot, da man befürchtete, dass der Spendenaufruf in die Tradition der nationalsozialistischen Winterhilfe gerückt werde. Diese Annahme war durchaus berechtigt, bekanntlich spielte das „Winterhilfswerk des Deutschen Volkes“ im Nationalsozialismus eine bedeutende Rolle.
Zu den Maßnahmen zählten Sach- und Lebensmittelspenden sowie Spendenaktionen wie Straßensammlungen, Sportwettkämpfe und Konzerte oder auch Sammeldosen in Geschäften. Da der organisatorische Aufwand enorm war, beschlossen die Nationalsozialisten eine prozentuale Zwangsabgabe auf Lohn und Gehalt der Arbeitnehmer einzuführen.
Spendensammlungen mit besonderem Schwerpunkt auf die Wintermonate existierten bereits nach dem Ersten Weltkrieg als effizientes Mittel kurzfristiger Hilfsaktionen. Die erste deutschlandweite Sammlung, die offiziell vom Begriff ‚Winterhilfe‘ geprägt wurde, fand von September 1931 bis März 1932 statt und brachte 42 Millionen Reichsmark ein. Veranlasst wurde sie durch eine Vereinigung namens Deutsche Liga der freien Wohlfahrtspflege darunter u.a. das Deutsche Rote Kreuz, der Deutsche Caritasverband sowie die Zentralwohlfahrtsstelle der deutschen Juden. Der im Dezember 1924 gegründete Zusammenschluss versammelte die überwiegende Zahl jener Spitzenverbände, die eine aktive und regional übergreifende freie Wohlfahrtspflege betrieben. Die sozialdemokratische Arbeiterwohlfahrt trat dem Verbund nicht bei, da man befürchtete, dass die politischen und vor allem weltanschaulichen Differenzen eine erfolgreiche Zusammenarbeit negativ beeinflussen würden.
Eine Überbrückung vergleichbarer Differenzen gelang mit Gründung der Volkssolidarität Dresden, die sich aus Vertretern der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD), der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD), der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands (CDUD), der Liberal-Demokratischen Partei Deutschlands (LDPD), der evangelischen und der katholischen Kirche sowie des Landesausschusses des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes (FDGB) zusammensetzte.
Über die Jahrzehnte der DDR-Zeit wurde die Volkssolidarität zum festen Ankerpunkt gelebter Wohlfahrtspraxis. Durch ihre umfassende Alltagspräsenz im Bereich der Nachbarschaftshilfe, Kinderbetreuung sowie der Betreuung älterer Menschen gelang der Übergang in die Nachwendezeit. Die Volkssolidarität ist heute ein eingetragener Verein, der insbesondere in den ostdeutschen Bundesländern als Vorbild für den Umgang mit gesellschaftlicher Verantwortung angesehen wird.
Dr. Sylvia Drebinger-Pieper
Quellen:
Stadtarchiv Dresden, Landeszeitung der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands „Volksstimme“ vom 04.11.1945, Nr. 46, S. 1.
Spendendose Leihgabe der Volkssolidarität Dresden
Oktober 2025
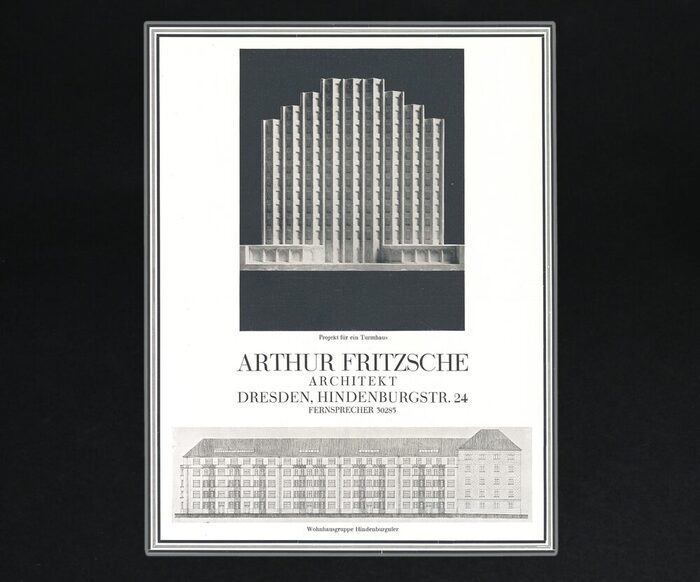
„Komfortable Wohnhäuser mit Elbblick“. Vor 100 Jahren wurde die Bebauung des Johannstädter Elbufers nach Osten hin erweitert
Mit der Neufassung des Bebauungsplanes für die Johannstadt im ausgehenden 19. Jahrhundert und dem Ortsgesetz für Johannstadt-Nord von 1898 konnte mit dem Umbau des Industriestandortes in einen lukrativen Wohnort begonnen werden. Im Fokus stand dabei insbesondere die Elbufergestaltung. Bis um 1915 war die Bebauung des einstigen Hindenburgufers (heute Käthe-Kollwitz-Ufer) mit Wohnhäusern in „vornehmer Lage mit Elbblick“ bis zum Feldherrenplatz (heute Thomas-Müntzer-Platz) nahezu abgeschlossen.
Nachdem im Jahre 1925 der Dresdner Architekt Arthur Fritzsche (1871–1943) und der Steinmetzmeister Valentin Sänger (1873–1934) Eigentümer angrenzender unbebauter Flächen am Hindenburgufer wurden, erfolgte der weitere Ausbau des Johannstädter Elbufers in Richtung Osten. Die Planungen zur Wohnanlage mit fünf Häusern, die jeweils über vier Etagen zuzüglich Erdgeschoss verfügten, lieferte Fritzsche selbst. Die insgesamt 55 Wohneinheiten bestachen durch eine gehobene Ausstattung und wurden unter anderem von Ärzten, Künstlern, Beamten, Ingenieuren und Lehrern bewohnt. Die Bauausführung der Häuserzeile als schlichter Putzbau mit expressionistischen dreieckigen Erkern erfolgte durch das Bauunternehmen ›Fritzsche & Sänger‹.
Nach Fertigstellung des ersten Hauses Nummer 24 im Jahre 1926 etablierten Fritzsche und Sänger im Erdgeschoss ihre neuen Geschäftsräume. Im Jahre 1929 konnten die Bauarbeiten abgeschlossen werden. Heute steht die von Arthur Fritzsche geschaffene Wohnanlage Käthe-Kollwitz-Ufer 24–28 als baugeschichtlich bedeutsam unter Denkmalschutz.
Zu Fritzsches weiterem architektonischen Erbe in der Johannstadt gehören das Eckhaus Heinrich-Beck-Straße 1/Blumenstraße 75b sowie das Wohnhaus Thomas-Müntzer-Platz 8. Dass der Architekt dabei weitaus größere Ideen für die Stadt Dresden geplant hatte und was diese mit Himmelskratzern auf dem Altmarkt‹ zu tun haben, erfahren Sie in unserer neuen Publikation »in civitate nostra Dreseden«: Verborgenes aus dem Stadtarchiv, Zweites Buch, die im Januar 2025 erschienen ist. Die limitierte Auflage ist exklusiv nur über das Stadtarchiv Dresden erhältlich. Weitere Informationen zum Buchverkauf finden Sie unter: www.dresden.de/stadtarchiv.
Carola Schauer
Quelle: Stadtarchiv Dresden, 18 Wissenschaftlich-Stadtgeschichtliche-Fachbibliothek, Nr. 78.41, S. 288
September 2025
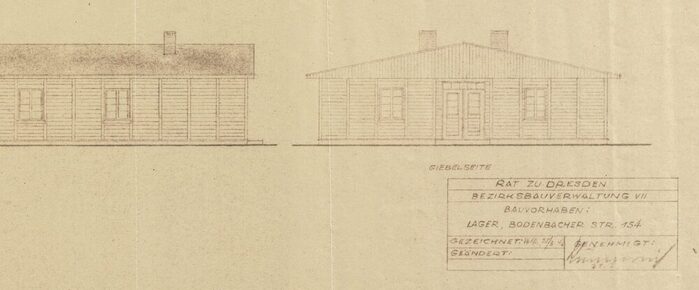
Erinnerungsort Bodenbacher Straße 154
Das Stadtarchiv erinnert mit einer historischen Zeichnung an die provisorischen Notunterkünfte, die unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg in den Baracken des Gefangenenlagers für Zwangsarbeiter der Zeiss-Ikon AG auf der Bodenbacher Straße 154 entstanden sind. Verschiedene Schicksale und Lebensgeschichten verbinden sich damit an einem Ort, wie die von der gebürtigen Litauerin Veronika Kapitanowa aus Kaunas. Sie war eine von vielen Zwangsarbeiterinnen aus ganz Europa, die vor 1945 in den über 50 Holzbaracken leben mussten. Als damals 16-Jährige wurde sie 1942 in Folge der deutschen Besatzung von Litauen nach Dresden verbracht, wo sie als Stanzerin im Werk Reick der Zeiss-Ikon AG auf der Mügelner Straße 40 in Dresden Zwangsarbeit leistete. Veröffentlicht ist ihre Biografie über die Datenbank www.dresdner-friedhoefe.de, ein Webportal der Gedenkstätte Münchner Platz Dresden/Stiftung Sächsische Gedenkstätten, welches über die Gräber der Opfer von staatlicher Gewalt und Kriegen des 20. Jahrhunderts auf Dresdner Friedhöfen informiert.
Zu Veronika Kapitanowa heißt es darin, dass ihr Arbeitgeber sie im Februar 1944 wegen wiederholten Fehlens am Arbeitsplatz anzeigte. Daraufhin verwarnte sie das zuständige Polizeirevier. Von einer Inhaftierung sahen die Beamten wegen ihres jugendlichen Alters ab. Einige Wochen später wurde sie als arbeitsunfähig in die Sanitätsstation ihres Wohnlagers eingewiesen. Die notwendige Verlegung in ein Krankenhaus wurde bis zum 30. April 1944 hinausgezögert. An diesem Tage verstarb die erst 18-Jährige im Krankenhaus Friedrichstadt an Lungentuberkulose. Sie wurde auf dem Neuen Katholischen Friedhof beerdigt. Die Sterbeurkunde mit dem Verweis auf das Lager Bodenbacher Straße 154 als Wohnort ist im Stadtarchiv Dresden archiviert.
Nach Befehl der Sowjetischen Militäradministration wurden die Baracken unmittelbar nach Kriegsende der Abteilung Soziale Fürsorge der Stadt Dresden übergeben. Ab November 1945 setzte daraufhin das Hochbauamt Dresden 35 Baracken instand und errichtete darin 230 provisorische Notwohnungen für Hilfsbedürftige. Die Abbildung zeigt den Ausschnitt einer Zeichnung, die im Jahr 1946 das Instandsetzungsvorhaben der Baracken im Lager dokumentiert. In den Bauunterlagen von 1948 wird der Zustand der Baracken als menschenunwürdig beschrieben. Seit der Auflösung der Notunterkünfte wurde das Areal auf der Bodenbacher Straße 154 für das städtische Sportwesen genutzt.
Annemarie Niering
Quelle: Stadtarchiv Dresden, 10 Bau- und Grundstücksakten, Nr. 39418.
August 2025
Eine automatische Personenwaage für das Luftbad Weißer Hirsch
Sommerzeit ist Bäderzeit. So ist es heute und so war es auch zu Beginn des 20. Jahrhunderts schon. Neben den Schwimmbädern waren es vor allem die Licht- und Luftbäder, die viele Gäste mit den unterschiedlichen Angeboten anlockten. Diese Badeanstalten verbanden die Idee des therapeutischen Luftbads mit der Form der Lichttherapie durch natürliches Sonnenlicht. Alles in allem ging es vor allem um Erholung und Bewegung an der frischen Luft.
So ein öffentliches Luft- und Sonnenbad befand sich im Waldpark Weißer Hirsch. Für den Sommer 1906 hatte der Gemeinderat eine besondere Attraktion für die Besucher angedacht, und zwar die Anschaffung einer großen Personenwaage. Es wurde wohl von den Gästen bemängelt, dass in den meisten Badeanstalten eine zuverlässige Waage fehle. Deshalb entschied sich der Gemeinderat, für Abhilfe zu sorgen. Die „Actiengesellschaft für automatischen Verkauf“ mit Sitz auf der Zirkusstraße in Dresden erhielt den Auftrag. Die Ortsvorsteher entschieden sich sogar für zwei Apparate. Laut Firmenwerbung handelte es sich um „hochelegant ausgestattete“ Personenwaagen ganz aus Eisen, die zwei Meter hoch und 170 Kilo schwer seien. Der Geldeinwurf könne individuell zwischen 5, 10 und 20 Pfennigen gewählt werden. Die Kosten für beide Apparate beliefen sich auf 600 Mark.
Der Gemeinderat Weißer Hirsch hatte als Voraussetzung für den Kauf darauf bestanden, dass die beiden Geräte am 1. April 1906 für zwei Monate zur Probe aufgestellt wurden. Die „Actiengesellschaft für automatischen Verkauf“ stimmte den unter der Bedingung zu, dass der Kauf nur dann rückgängig gemacht werde, wenn die Waagen technisch nicht funktionieren. Bereits im Mai sollte die Firma die Apparate wieder abholen, da sie laut Gemeinderat nicht das richtige Gewicht anzeigen würden, scheinbar hatte es unter den Badegästen Beschwerden gegeben. Nach Prüfung der Personenwaagen hielt der Aufsteller schriftlich fest, dass die Waagen technisch einwandfrei funktionierten und entgegnete dem Gemeinderat, dass „Leute die sich beschweren, sind meist die, die nicht wissen, was sie wiegen – bekanntlich starke Damen“. Der Satz brachte das Fass zum Überlaufen, und war der Beginn eines wahren Rechtsstreits. Eine fortfolgende Diskussion verlief ausschließlich über die Anwälte der jeweiligen Konfliktparteien. Letzen Endes lies die „Actiengesellschaft für automatischen Verkauf“ die Personenwaagen wieder abholen, ohne dass es zum Kauf kam.
Dr. Marco Iwanzeck
Quelle: Stadtarchiv Dresden, 8.58 Gemeindeverwaltung Weißer Hirsch, Nr. 126.
Juli 2025
Die bewegte Geschichte des Naturfreunde-Vereins in Dresden
Von den Bemühungen der Stadtbewohner Schmutz, Enge und Elend zumindest zeitweise zu entfliehen, erzählt ein roter Stoffwimpel mit dem Emblem des Vereins der Naturfreunde im Stadtarchiv Dresden. Das im Gründungsjahr entworfene Logo zeigt zwei sich haltende Hände als Zeichen der Solidarität mit der Arbeiterbewegung sowie drei Alpenrosen im oberen Bildbereich.
Der ursprünglich in Wien gegründete Verein erreichte in der Zeit Weimarer Republik auch auf deutschem Gebiet seinen Verbreitungshöhepunkt. Besonders in Sachsen, als Ort einer ausgeprägten Arbeiterbewegung, fanden die „Naturfreunde“ regen Zuspruch. Die erste Dresdner Ortsgruppe entstand im Juli 1909 in Löbtau. Bis zu Beginn der 1930er Jahre hatten die „Naturfreunde“-Dresden eine Mitgliederzahl von 2.100 Personen erreicht. Die große Beliebtheit des Vereins resultierte unter anderem aus der Unterhaltung der sogenannten Naturfreundehäuser, welche als Unterbringung beim Wandern dienten und über die eigentlichen Mitglieder hinaus großen Anklang fanden. Für das Naturfreundehaus am Zirkelstein bei Schmilka sind beispielweise 21.000 Übernachtung im Jahr 1932 nachweisbar.
Bekanntlich entwickelten sich im Anschluss an den Ersten Weltkrieg gesellschaftliche Spannungen, welche von Polarisierung und Radikalisierung gekennzeichnet waren. Die Koexistenz von unterschiedlichen Ideologien führte zur Abspaltung der Randgruppe „Naturfreunde-Opposition Vereinigte Kletterabteilung“ (NFO-VKA) in Dresden, die eine in großen Teilen trotzkistische Linie vertraten im Gegensatz zu den sozialdemokratischen, SPD-nahen „Naturfreunden“. Infolge der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten wurden beide Vereine verboten. Vereinsmitglieder, die bei der Weitergabe von Literatur aus der Prager Exilzentrale erwischt wurden, gerieten in Konzentrationslager.
Eine Neugründung auf dem Staatsgebiet der DDR war aufgrund der bestehenden Gesetzmäßigkeiten zum Vereinswesen nicht möglich. Ehemalige Mitglieder und Vereinsstrukturen wurden in Einheitsbewegungen eingegliedert. Erst nach der Wende kam es zur Wiedergründung der Ortsgruppe Dresden am 10. März 1990. Obwohl die Ideale des Vereins vor allem im ökologischen Bereich ähnlich geblieben sind, haben sich die Naturfreunde über die vergangene Zeit und durch das 50 Jahre anhaltende Verbot verändert. Die Verschiebung des ehemaligen Arbeitervereins in das bürgerliche Milieu führte zu einer Fokussierung auf Themen wie die Förderung einer offenen Gesellschaft, nachhaltigem Umgang mit den Ressourcen der Umwelt sowie dem Umsetzten eines sanften Tourismus, bei dem die Natur trotz menschlichen Einflusses gewahrt und geschützt wird.
Helma Thomas
Quelle: Stadtarchiv Dresden, 13.117 Naturfreunde e.V., Nr. 1
Juni 2025
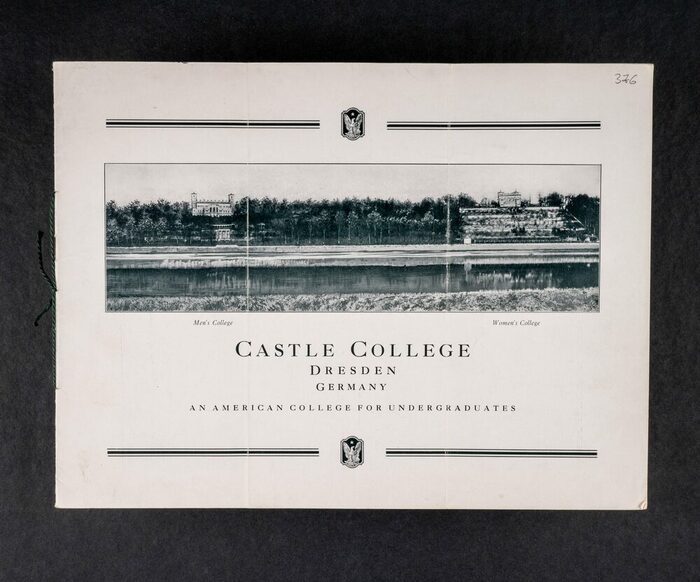
Die Idee von einer amerikanischen Eliteuniversität auf Schloss Albrechtsberg
Im April 1927 erreichte den Rat der Stadt Dresden eine außergewöhnliche Anfrage. Der Ingenieur Friedrich Albert Karl Ernst Kaltschmidt (1879–1949) bemühte sich um die Einrichtung einer amerikanischen Eliteuniversität in Dresden und reichte zu diesem Zweck eine mehrseitige Werbebroschüre mit dem Titel »Castle College Dresden Germany An American College for Undergraduates« ein.
Kaltschmidts Privatinitiative stand stellvertretend für weitere Eingaben, die die Verwendung des Areals um das Schloss Albrechtsberg betrafen. Ausgangspunkt war die Tatsache, dass die Stadt bis zu diesem Zeitpunkt keinen Nutzungsplan für das Gebäudeensemble entwickelt hatte, obwohl sich das Schloss seit 1925 in städtischem Besitz befand. Erster Ansprechpartner für Kaltschmidt war der damalige Dresdner Oberbürgermeister Curt Bernhard Ottomar Blüher (1864–1938), der diesen Posten vom 1. Oktober 1915 bis zum 31. März 1931 begleitete. Für seinen ehrgeizigen Plan erstellte Kaltschmidt oben benannte Broschüre als Anschauungsmaterial mit beschreibenden Texten und Abbildungen. Geplant war eine amerikanische Universität auf deutschem Boden mit circa 200 Studenten, von denen drei Viertel amerikanischer Herkunft und ein Viertel deutscher Staatsbürgerschaft sein sollten. Erklärte Ziele waren die Stärkung der deutschen Kultur- und Bildungspolitik sowie der Ausbau internationaler Beziehungen.
Die von Kaltschmidt veröffentlichte Broschüre stellte die Gesamtidee mit all ihren Vorzügen vor. Während Schloss Albrechtsberg, das Domizil des ehemaligen Prinzen Albrecht von Preußen (1809–1872), als Schule für Herren beworben wurde, war das Lingnerschloss den weiblichen Studentinnen vorbehalten. Zur Unterbringung und Versorgung standen zudem sechs weitere kleinere Gebäude, eingerichtet nach neuesten Standards, zur Verfügung. Darüber hinaus bestand auch die Option zur Unterbringung bei ausgewählten Dresdner Familien. Die Aufwendungen für Kost und Logis lagen bei 120 Dollar pro Monat ohne Extras. Für Annehmlichkeiten sorgte der 50 Hektar umfassende Park mit den griechischen Arkaden und dem Zugang zur Elbe. Der Fluss spielte bei der Freizeitgestaltung und ebenso hinsichtlich der Sportangebote wie Schwimmen, Rudern und Segeln eine enorme Rolle. Darüber hinaus sollten in den Grünanlagen Tennis- und Fußballplätze etabliert und der angrenzende öffentliche Wald für Pferdesport genutzt werden.
Die Generierung der notwendigen Geldmittel gestaltete sich schwierig, so dass nach einigen vergeblichen Interaktionen mit amerikanischen Partnern alternative Verwendungsweisen wie das ›Landeserziehungsheim der Großstadt für Mädchen‹ von Kaltschmidt vorgeschlagen wurden. Ab 1931 wandte sich Kaltschmidt mit einer erneuten Offensive an die Behörden auf Reichsebene, obwohl sich insbesondere die Stadt Dresden und das Land Sachsen aufgrund zweifelhafter Finanzplanung bereits distanziert hatten. Insbesondere das Fehlen detaillierter Lehrpläne machte die Behörden skeptisch und führte zur endgültigen Ablehnung des ambitionierten Projektes.
Diese und weitere Geschichten aus dem Dresdner Stadtarchiv finden Sie auch in der neuen Publikation »in civitate nostra Dreseden«: Verborgenes aus dem Stadtarchiv, Zweites Buch, die im Januar 2025 erschienen ist. Die limitierte Auflage ist exklusiv nur über das Stadtarchiv Dresden erhältlich. Weitere Informationen zum Buchverkauf finden Sie unter: www.dresden.de/stadtarchiv
Dr. Sylvia Drebinger-Pieper
Quelle: Stadtarchiv Dresden, Bestand 2.3.1 Hauptkanzlei, Nr. 78, Bl. 376-379
Mai 2025
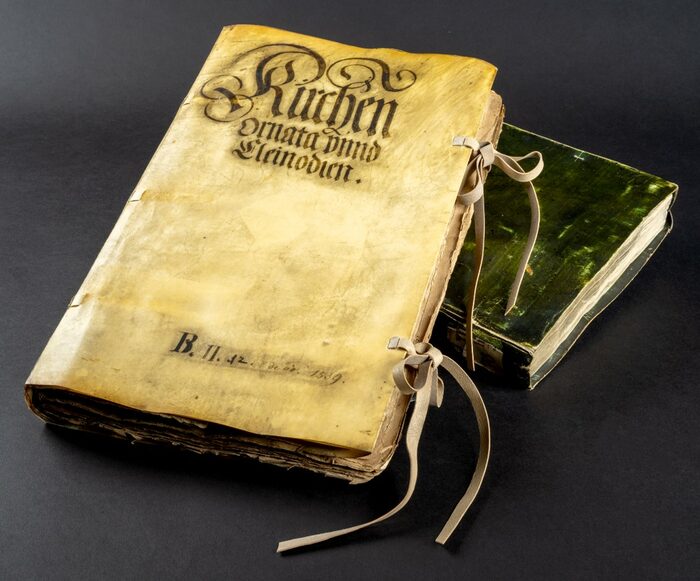
Reformation der Dinge. Der Dresdner Rat und die Einziehung der Kirchenschätze in Sachsen
Im historischen Archiv des Dresdner Rates, im Bereich B, welcher seit 1534 überwiegend Vorgänge der städtischen Kirchen- und Schulangelegenheiten sowie die Verwaltung der Mittel des frühneuzeitlichen Sozialwesens dokumentiert, findet sich eine in helles Pergament mit ledernen Schleifen gebundene Akte mit dem Titel: ›Die Kirchenornata und Cleynodien im Landt zu Meißen belangendes. Dabey findt man waß der Rath zu Dreßden anfenglich Anno Domini 1539 nach Hertzog Georgen zu Sachssen sel.[igen] Thode zu sich in Verwahrung genommen (…)‹.
Dabei handelt nicht allein um die 1539 begonnene Dokumentation der reformatorischen Veränderungen an den Ausstattungen der Dresdner Kapellen, Pfarr- und Klosterkirchen. Vielmehr findet sich darin nahezu die gesamte Markgrafschaft Meißen inventarisiert. Die Objektlisten bedeutender Klöster, wie St. Afra und Altzella sind darin ebenso eingebunden, wie diejenigen kleiner Pfarrkirchen und Kapellen in den Städten und auf dem Land – etwa in Annaberg und Döbeln, Dittmannsdorf oder Siebenlehn. In den Anschreiben an den Dresdner Rat finden sich mitunter ausführliche Situationsschilderungen der zeitgenössischen Akteure.
Blatt 1 bildet ein gedruckter Handzettel mit der 1539 ergangenen Verordnung Heinrichs von Sachsen (1473–1541), welcher in die einzelnen Orte versendet worden war. Der knappe Text formuliert die Aufforderung, die Kirchenkleinodien in den Städten und im Territorium, außer den Kelchen, die man zur Kommunion brauche, »dem Lande zum besten« in sichere Verwahrung zu nehmen. Für »Düringen« solle das beim Rat der Stadt Leipzig geschehen und für die Markgrafschaft »Meissen« beim Rat zu Dresden.
Am 6. Juli 1539 wurde die Reformation des Dresdner Kirchenwesens mit einem Gottesdienst in der Kreuzkirche feierlich initiiert. Danach sollten auch im Territorium rasch Fakten geschaffen werden. Neben durchzuführenden Visitationen, zielte Heinrichs Verordnung zur Sicherstellung der nunmehr als überflüssig bewerteten Kirchenausstattungen auch auf eine Reform der kirchlichen Sachkultur. Messgeschirr, wertvolle Reliquien und deren kunstvolle Behältnisse, aufwändig bestickte Altarbehänge und liturgische Gewänder, kurz: die Gegenstände und Instrumente spätmittelalterlicher Liturgie und Frömmigkeitspraxis wurden obrigkeitlich eingezogen. Der Dresdner Rat wirkte dabei im Bereich der Mark Meißen als ausführender ‚Logistikpartner‘ des Landesherrn. Damit wurde auf der Ebene der religiösen Sachkultur landesweit eine einschneidende Zäsur vollzogen. Die landesgeschichtlich bedeutsame Quelle lässt die seither verschwundenen spätmittelalterlichen Ausstattungsensembles sächsischer Kirchen, Kapellen und Klöster und die Praxis ihrer reformatorischen Umwandlung für kulturhistorische Forschungen rekonstruierbar werden.
Dr. Stefan Dornheim
Quelle: Stadtarchiv Dresden, Bestand 2.1.2 Ratsarchiv, B.II.12.
April 2025
„Die Neue Börse zu Dresden“ - Die Einweihung des Börsengebäudes vor 150 Jahren
In den Jahren 1874/75 ließen sich die Mitglieder der Dresdner Börse ein eigenes repräsentatives Gebäude an der Waisenhausstraße 11 errichten. Als Archivale des Monats April zeigt das Stadtarchiv Dresden vor dem Lesesaal einen Bildband mit dem historischen Börsengebäude.
Bereits im Eröffnungsjahr 1857 der Börse zählte der Verein 120 Mitglieder und der Wertpapierhandel gewann in Dresden an Zuspruch. Die Börsenversammlungen fanden zu diesem Zeitpunkt in unterschiedlichen Lokalen statt. Neben Kurszetteln aus London, Amsterdam und Rotterdam wurden vor allem Aktien ansässiger Unternehmen gehandelt, so unter anderem von der Felsenkeller-Brauerei, der Sächsischen-Champagner-Fabrik oder der Dresdner Feuerversicherung. Für einen funktionierenden Börsenbetrieb wurde es dringend notwendig einen eigenen Standort zu begründen. Darum ließen sich die Mitglieder von den Architekten Albin Zumpe und Guido Ehrig auf dem Grundstück zwischen Waisenhausstraße 11 und Friedrichsallee (heute Dr.-Külz-Ring) ein eigenes repräsentatives Börsengebäude im Neorenaissancestil mit Sandsteinfassade errichten. „Die Neue Börse zu Dresden“, wie die Architekten das Gebäude nannten, wurde am 1. April 1875 eröffnet und verfügte über Zugänge von beiden Straßenseiten. Die große Vorhalle im Erdgeschoss diente auch als Sommerbörse. Der Börsensaal im Hauptgeschoss, mit Front zur Friedrichsallee, hatte eine Größe von rund 290 Quadratmeter.
Entgegen behördlicher Prognosen, dass die „Provinzbörse“, wenn überhaupt, nur lokale Bedeutung erlangen könne, entwickelte sich diese bis zum Beginn der 1930er-Jahre zur größten Börse Sachsens. Beim Geschäft mit Brauereiaktien hatte sich Dresden zum bedeutendsten Handelsplatz Deutschlands etabliert, denn hier notierten mehr Brauereien als an der großen Berliner Börse. Nach dem Machtantritt der Nationalsozialisten und der nachfolgenden Umstrukturierung des Börsensektors wurde 1935 der Börsenbetrieb in Dresden eingestellt, die Auflösung beschlossen und die Liquidation am 31. Mai 1937 beendet. Bei den Bombenangriffen auf Dresden im Februar 1945 wurde das Börsengebäude zerstört und nachfolgend nicht wieder aufgebaut.
Carola Schauer
Quelle: Stadtarchiv Dresden, 18 Wissenschaftlich-Stadtgeschichtliche Fachbibliothek, F2.004a, Bl. 71
März 2025
Von Elektrikern, Kakteen und Augentropfen - Geschichten aus dem Brigadetagebuch der Staatlichen Pfauen-Apotheke
Im Elbcenter in Pieschen, auf der Leipziger Straße 118, befindet sich die Pfauen-Apotheke. Seit über 100 Jahren findet man hier Beratung und Abhilfe zu allerlei Beschwerden. Ursprung ist die frühere Moltke-Apotheke, die viele Jahre lang an der Leipziger Straße Ecke Moltkestraße ansässig war. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden Straße und Apotheke umbenannt – in Robert-Matzke-Straße und Pfauen-Apotheke. Einige Jahre später kam der Namenszusatz „Staatliche“ hinzu, nachdem der damalige Leiter, Herr Georg Bromig, die Apotheke 1956 in staatliche Hand übergab.
Ein Jahrzehnt und einige Leitungswechsel später übernahm der Pharmazierat Molinnus die Leitung der Pfauen-Apotheke. Mit diesem Strukturwechsel setzte sich die Apotheke ein neues Ziel: die inzwischen insgesamt 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter strebten gemeinsam an, den Titel „Kollektiv der sozialistischen Arbeit“ zu erlangen. Mit dieser Auszeichnung wurden seit 1960 solche Kollektive, Abteilungen oder Brigaden gewürdigt, die nachweislich besonders hohe Leistungen im sozialistischen Wettbewerb erbrachten - in politischer, fachlicher und kultureller Hinsicht. Nachweisinstrument für die Erfüllung dieser Anforderungen war üblicherweise ein Brigadetagebuch.
Die Staatliche Pfauen-Apotheke begann also am 2. Mai 1967 mit der Führung eines solchen Buches. Es sollte gemeinsam angegangene Projekte und das soziale und politische Engagement der Brigademitglieder festhalten. Beginnend mit einer Anekdote über eine überraschende Brandschutzkontrolle kurz nach Dienstantritt des neuen Apothekenleiters erzählt das erste Brigadetagebuch der Pfauen-Apotheke von neuen Kolleginnen und Kollegen, gemeinsamen Ausflügen, Räumungsaktionen und Technikproblemen, der Übernahme einer Außenstelle in Übigau, Festen und Feiern und vielem mehr. Als selbsternannte Chronistin der Pfauen-Apotheke führte dieses erste Tagebuch mit Ausnahme einzelner Einträge vorrangig Frau Ulbricht, die zu Beginn der Eintragungen selbst erst seit einem halben Jahr in der Pfauen-Apotheke tätig war. Spätere Brigadetagebücher der Apotheke wurden als gemeinschaftliche Aufgabe von verschiedenen Mitarbeitern geführt.
1967 bewarben sich laut Angaben aus dem Tagebuch neben der Staatlichen Pfauen-Apotheke vier weitere Apotheken um den Titel „Kollektiv der sozialistischen Arbeit“. In den Beständen des Stadtarchivs finden sich drei Urkunden, die belegen, dass die Pfauen-Apotheke ihr Ziel erreichte - in den Jahren 1970, 1972 und 1974 gewann sie die Auszeichnung.
Theresa Jäger
Quelle: Stadtarchiv Dresden, 17.2.102 Sammlung Wirtschafts- und Industriegeschichte, Nr. 83 Band 1
Februar 2025

Reiche Ernte, Qualität und Frische - Das Frühgemüsezentrum Dresden
Das Dresdner Elbtal gehört seit jeher zu den traditionellen Anbaugebieten für Gemüse. Aufgrund fruchtbarer Böden und milden Klimas herrschen hierfür ideale Bedingungen. Lange Zeit geschah die Bewirtschaftung hauptsächlich durch kleine und große Familienbetriebe. Infolge der Kollektivierung der Landwirtschaft ab 1952 entstanden sowohl Landwirtschaftliche als auch Gärtnerische Produktionsgenossenschaften (LPG, GPG), von denen zehn zum 1. Januar 1973 zur LPG Frühgemüsezentrum Dresden zusammengeschlossen wurden. Der neue landwirtschaftliche Großbetrieb erstreckte sich rechtselbisch von Kaditz über Radebeul bis Zitzschewig und links der Elbe von Stetzsch über Gohlis bis Weistropp auf einer Fläche von insgesamt 1.556 Hektar, wovon man 600 Hektar für den Freilandgemüseanbau und 24 Hektar zur Kultivierung im Gewächshaus nutzte.
Der Sitz befand sich auf der Grimmstraße 79, später auf der Kötzschenbrodaer Straße 58. Zu Spitzenzeiten waren über 1.200 Menschen damit beschäftigt, ungefähr 25 Gemüsesorten – allen voran Gurken, Blumenkohl, Möhren, Kopfsalat sowie Tomaten – zu züchten, anzubauen und zu vermarkten oder sich um die maschinelle Ausstattung der LPG zu kümmern. Daneben begleitete wissenschaftliche Forschung den Arbeitsalltag. Einige Innovationen konnten erfolgreich erprobt werden, wie etwa neuartige Gewächshäuser mit Thermoverglasung sowie die Aufzucht von Tomaten in kleinen, mit Mineralwolle gefüllten Containern mit Tropfenbewässerung. Generell trieb man industrielle Produktionsmethoden voran, die „Schubkarrenzeiten“ sollten der Vergangenheit angehören.
Es ging letztlich darum, ein breites Sortiment an frischem Gemüse in guter Qualität bereitzustellen. Geliefert wurde vorranging an Einzel- und Großhandel sowie Küchen und gastronomische Einrichtungen im Ballungsgebiet Dresden, aber auch nach Berlin, ins westliche Sachsen und in den Thüringer Raum. Mit der politischen Wende änderten sich massiv die Marktbedingungen. Die LPG zerfiel, der Kaditzer Teil wurde 1990 als GmbH neu gegründet. Schließlich etablierte sich das Frühgemüsezentrum wieder, bis im Januar 2024 ein Insolvenzverfahren die wirtschaftliche Notlage aufzeigte. Zu hoffen bleibt, dass der traditionsreiche Gemüseanbau im Dresdner Westen erhalten bleibt.
Patrick Maslowski
Quelle: Stadtarchiv Dresden, 6.4.40 Stadtplanungsamt, Bildstelle, Nr. IX796 (2)
Januar 2025
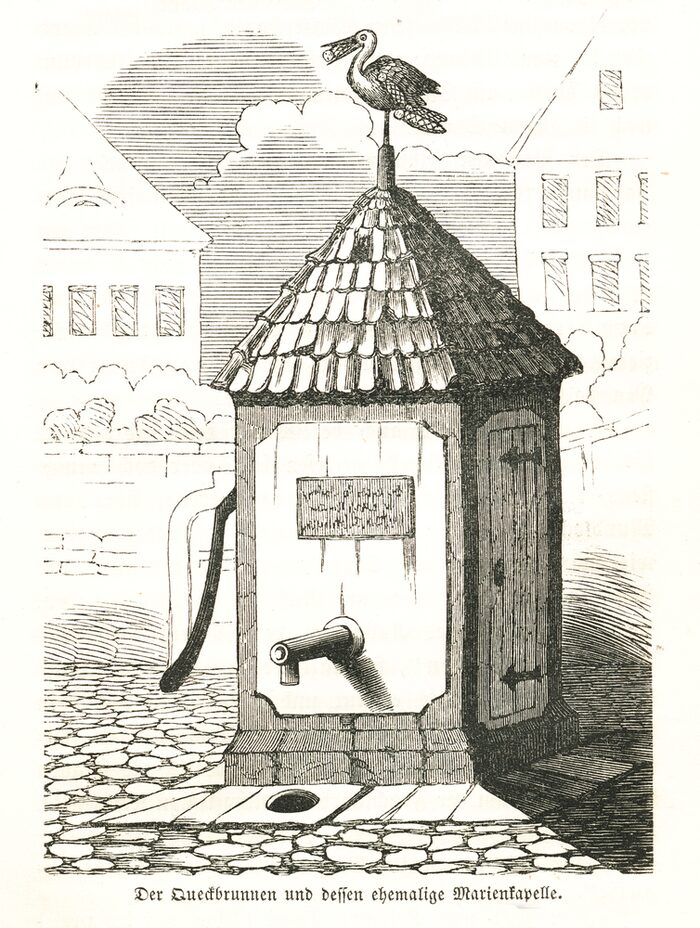
Der Queckbrunnen – ein Dresdner Wahrzeichen
Wahrzeichen beschreiben oftmals einzigartige Bauten, die uns als wiedererkennbare Sehenswürdigkeiten in Erinnerung bleiben. Indem sie für ein bedeutendes historisches Ereignis stehen, das Stadtbild oder die Stadtsilhouette prägen oder weithin sichtbar sind, werden sie zum Symbol, zum „Zeichen“ des Ortes. Bis zum frühen 19. Jahrhundert bedeutete der Begriff Wahrzeichen allerdings nicht die Wiedergabe von Allerweltswissen über einen bestimmten Ort, sondern eher dessen Gegenteil: Die genaue Kenntnis geheimer lokaler Zeichen, die man nur kennen konnte, wenn man tatsächlich eine Zeit lang in Vertrautheit mit einem Ort und seinen Bewohnern gelebt hatte. Es handelte sich also um ein System geheimer Wissenscodes der Vormoderne, die Aufenthalte bestätigen sollten. In der Regel handelte es sich bei diesen Symbolen um kleinere, nicht selten versteckte Objekte in der populären städtischen Erinnerungstopographie: sagenhafte Orte und Gebäude, alte Gedenksteine und Inschriften, kuriose Figuren und Objekte.
Der 1461 urkundlich erwähnte Queckbrunnen, auch Queckborn genannt, ist ein solches Wahrzeichen. Es handelt sich hierbei um den ältesten Brunnen der Stadt, der sich bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt erhalten hat. Ursprünglich befand sich der Queckbrunnen auf einer Viehweide außerhalb der Stadtmauern nordwestlich des Wilsdruffer Tors. Errichtet wurde er sowohl zur Wasserversorgung für die Gerbergemeinde als auch als Viehtränke für die umliegenden Weiden. Der Queckbrunnen wurde mehrfach renoviert und umgesetzt. Bis 1968 stand er mitten auf der Straße „Am Queckbrunnen“. Auf der Dachspitze befindet sich eine Storchenfigur, die Wickelkinder im Schnabel, in den Fängen und den Flügeln trägt. Der Legende nach holt der Storch die Kinder aus dem Queckbrunnen und bringt sie den Eltern. Der Storch steht in dieser Hinsicht für Fruchtbarkeit, Neuanfang und Glück.
Mehr über verborgene Wahrzeichen und Städtecodes erfahren Sie in der neuen Publikation „in civitate nostra dreseden“, Zweites Buch, sowie in der Ausstellung „Neue verborgene Geschichte(n) aus dem Stadtarchiv“. Das Buch wird am 20. Januar 2025, um 19 Uhr, zur Vernissage im Stadtarchiv präsentiert.
Marco Iwanzeck
Quelle: Stadtarchiv Dresden, 18 Wissenschaftlich-Stadtgeschichtliche Fachbibliothek, B70.1506
Archivalien des Monats aus dem Jahr 2024
Dezember 2024
Der Rabenonkel – ein Märchen von Victor Blüthgen mit Zeichnungen von Kurt Fiedler
Weihnachtszeit ist Märchenzeit. Die Klassiker der Gebrüder Grimm oder die russischen Märchen kennt so gut wie jedes Kind. Doch die Märchenwelt ist weit vielseitiger als gedacht. In ihr verstecken sich unbekannte Geschichten, die ebenso schön sind. Es lohnt sich, diese zu entdecken. Deshalb präsentiert das Stadtarchiv Dresden als Archivalie des Monats vier Zeichnungen zu einem weniger bekannten Märchen des deutschen Dichters und Schriftstellers Victor Blüthgen (1844–1920), die im Dezember im Lesesaal des Stadtarchivs Dresden, Elisabeth-Boer-Straße 1, zusammen mit einem Textauszug zu sehen sind.
Das Märchen „Der Rabenonkel“ erschien vermutlich erstmals in Blüthgens Werk „Hesperiden – Märchen für Jung und Alt“ im Jahr 1878. Der Künstler Kurt Fiedler (1894–1950) fertigte um 1925 dazu vier Zeichnungen an, die zusammen mit weiteren seiner Kunstwerke im Jahr 2010 den Weg ins Stadtarchiv fanden. Ob diese je im Zusammenhang mit dem Märchen publiziert worden sind, ist nicht bekannt. Gefertigt wurden die Bildchen mit Tusche und Gouache auf kleinen Kartonkarten. Die lückenhafte Nummerierung auf den Kärtchen lässt vermuten, dass es ursprünglich weitere Abbildungen gab und Fiedler eventuell die komplette Geschichte bildlich darstellte. Kurt Fiedler illustrierte unter anderem zahlreiche Publikationen für den Zirkus Sarrasani, den Dürerbund und für deutschlandweit bekannte Dresdner Verlage.
Seine Illustrationen zum Rabenonkel erzählen von einer Welt, in der einmal ein Zwergenkönig eine Braut suchte. Auf seiner langen Reise fand er schließlich ein schönes Zwergenfräulein, in das er sich sofort verliebte. Doch wie es im Märchen so ist, konnten die beiden nicht ohne Umwege und Prüfungen heiraten. So kam es, dass er krank vor Kummer wurde. Sein Gefolge machte sich große Sorgen und beschloss, die geheimnisvolle Dame zu finden. Sie dachten sich drei Wettbewerbe aus, die alle Mädchen und Frauen im ganzen Land absolvieren sollten. Sie ließen überall ausrufen, dass der König diejenige heiraten würde, „die am besten singt, die am besten springt, die der Storch am liebsten traut“. Die Nachricht erreichte auch das Zwergenfräulein, das mit ihrem Onkel hoch oben in einer steilen Felswand lebte. Sie nannte ihn „Rabenonkel“, weil er einst einen Raben zähmte und auf diesem umherfliegen konnte. Mit Hilfe des Rabenonkels gelang es dem Zwergenfräulein alle Aufgaben zu bewältigen und die Wettbewerbe zu gewinnen. Am Ende wurde groß Hochzeit gefeiert. Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie noch heute.
Susanne Koch
Quelle: Stadtarchiv Dresden, 17.6.3.5 Fiedler, Kurt, Nr. 64
November 2024
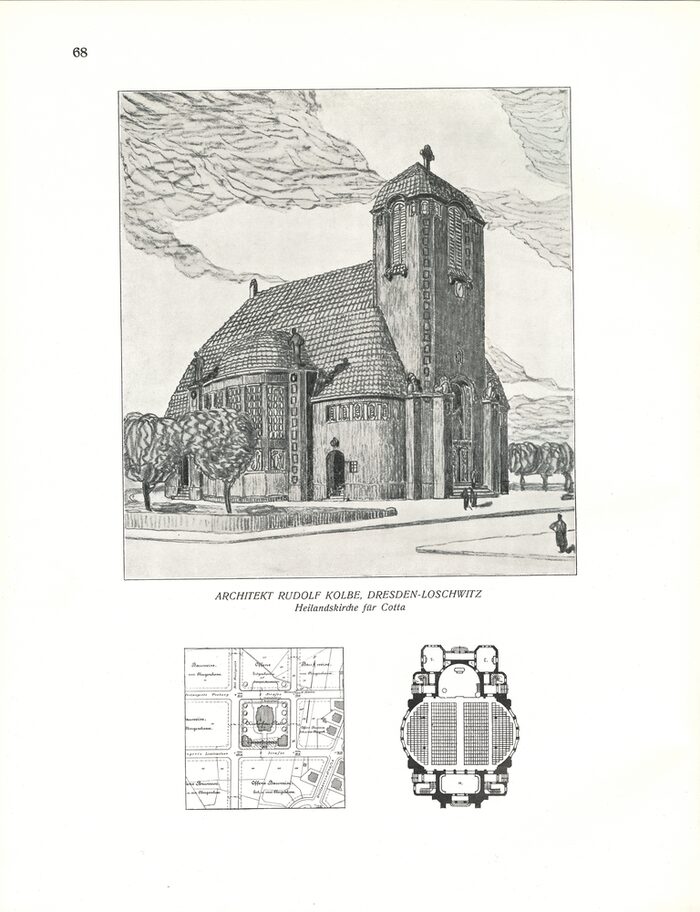
Der Traum von der eigenen Kirche - Ein Geduldsspiel für die Gemeinde Cotta
Anfang der 1890er Jahre wächst in der Dorfgemeinde Cotta der Wunsch nach Eigenständigkeit. Offiziell gehört die kleine evangelische Gemeinde zum Kirchspiel Briesnitz, doch seit 1893 werden regelmäßig eigene Gottesdienste in der Turnhalle der Volksschule Cotta veranstaltet. Die Ortschaft und ebenso die Kirchgemeinde gewinnt stetig an Zuwachs und es wird immer deutlicher, dass eine Schulturnhalle kein dauerhafter Veranstaltungsort sein kann.
Eine Kirche muss her. Ein Blick auf die vorhandenen Mittel zerschlägt diesen Traum jedoch schnell wieder. 1895 entsteht als Übergangslösung die kleine Interimskirche der Gemeinde und wenige Jahre später ist auch der Schritt in die Selbstständigkeit vollbracht: die Parochie Cotta spaltet sich 1896 endgültig vom Kirchspiel Briesnitz ab. Während die neue Kirchgemeinde gedeiht, werden im Hintergrund finanzielle und räumliche Vorbereitungen für den gewünschten Kirchenbau getroffen. 1908 kommt der Kirchenvorstand auf die Idee, einen Wettbewerb unter den Dresdner Architekten zu veranstalten, um einen geeigneten Entwurf zu finden. Es kommt zu einer regen Teilnahme am Wettbewerb. Nicht weniger als 68 Entwürfe werden eingereicht, darunter auch einer des Architekten Rudolf Kolbe. Im April 1909 verkünden die Preisrichter drei Sieger des Wettbewerbs. Der erstplatzierte Entwurf stammt von Fritz Schumacher, doch auch weitere Entwürfe werden dem Vorstand der inzwischen in Heilandsparochie umbenannten Kirchgemeinde zum Ankauf empfohlen.
Schnell wird erkenntlich, dass der Entwurf Fritz Schumachers mit den vorhandenen Mitteln unmöglich realisierbar sein wird. Auch weitere Abwägungen verzögern den Entschluss, doch 1912 wird letztendlich der inzwischen leicht veränderte Entwurf Rudolf Kolbes zur Ausführung gewählt. Zwei Jahre später beginnt der lang herbeigesehnte Kirchenbau. Wenige Monate nach Baubeginn jedoch bricht der Erste Weltkrieg aus und der Kirchenvorstand sieht sich gezwungen, den Bau auszusetzen. So wird aus der Heilandskirche noch vor Fertigstellung eine Kirchenruine. Elf Jahre lang muss die Gemeinde warten und hoffen, denn die ursprünglichen Baufonds sind erloschen und die Nachkriegszeit treibt die Materialpreise in die Höhe, gefolgt von der Inflation der 1920er Jahre.
Doch die Treue der Gemeinde und des Architekten Rudolf Kolbes zu der gemeinsamen Sache zahlt sich aus. Durch finanzielle Unterstützung verschiedener Interessengruppen wird der Bau 1925 wieder aufgenommen, wenn auch nun aufgrund der veränderten Umstände in schlichterer Gestalt. Ohne größere Unterbrechungen braucht es nun nur noch zwei Jahre, bis die Heilandskirche am Himmelfahrtstag dem 26. Mai 1927 geweiht wird.
Theresa Jäger
Quelle: Stadtarchiv Dresden, 18 Bibliothek, Z.237
Oktober 2024
Das „Nürnberger Ei“ - Eine Wohngebietsgaststätte für den Dresdner Süden
Mitte der 1950er Jahre wurde das kriegszerstörte Gebiet um die Nürnberger Straße neubebaut. Im Rahmen eines Sonderprogramms für Bergarbeiter der Wismut entstanden hier dringend benötigte Wohnungen mitsamt dazugehörigen Einkaufsmöglichkeiten – wie beispielsweise Läden für Lebensmittel, Bekleidung sowie für sonstige Waren des täglichen Bedarfs – und eben einer Speisegaststätte, dem „Nürnberger Ei“, am westlichen Ende des gleichnamigen Platzes. Am 1. Oktober 1958 wurde die von der staatlichen Handelsorganisation (HO) betriebene Gaststätte beziehungsweise Versorgungseinrichtung, wie es im zeitgenössischen Sprachgebrauch auch hieß, eröffnet. Sie war großzügig und sachlich modern eingerichtet und machte durch ihr Äußeres mit Terrasse und bodentiefen Fenstern einen einladenden Eindruck. Als eine der größeren Gaststätten im Stadtgebiet bot sie Platz für 250 Gäste sowie einen Versammlungsraum für 60 Personen.
Keineswegs sollten jedoch nur Speisen zur Mittags- und Abendzeit zum dortigen Verzehr angeboten werden. Die Einrichtung erfüllte noch eine weitere Funktion. Um nämlich die berufstätige Frau zu entlasten, konnte „preiswertes und geschmackvolles Essen in Trägern“ mit nach Hause genommen werden, wie ein Artikel der Sächsischen Zeitung zur Eröffnung mitteilte. Abseits dessen kehrte man hier natürlich auch gern nach Feierabend ein. Für die Menschen der umliegenden Häuser hatte das „Nürnberger Ei“ also einen vielfältigen Nutzen.
Ein Blick auf die Speisenkarte verrät, was damals gern gegessen wurde: deftige, nahrhafte, kalorienreiche, fleischbasierte Hausmannskost wie Schnitzel, Steak, Gulasch, Roulade, Sauerbraten und Geschnetzeltes. Als Vorspeisen gab es wahlweise Soljanka, Tomaten- oder Zwiebelsuppe, danach Vanilleeis. Für 20 bis 30 Mark konnte sich eine vierköpfige Familie satt essen.
1992 kam es zum Abriss der Gaststätte zugunsten eines achtstöckigen Bürohauses. Zwar wurde Neues geschaffen, es verschwand aber damit sowohl ein ins bauliche Umfeld passendes Stück Architektur der 1950er Jahre, als auch ein bis dahin beliebter Treffpunkt und eine Einkehrmöglichkeit für die Anwohner.
Patrick Maslowski
Quelle: Stadtarchiv Dresden, 6.4.40 Stadtplanungsamt, Bildstelle, II9190
September 2024
„110 Stück Schulbänke Modell B für hiesige Schule zu liefern“. Die Dresdner Schulbankfabrik A. Lickroth & Cie.
Vor wenigen Wochen hat das neue Schuljahr begonnen. Während der Sommerferien standen die Schulgebäude verlassen, und die Zeit wurde genutzt, um notwendige Reparaturen durchführen und abgenutztes Mobiliar auszutauschen. Dazu hätte sich vor einhundert Jahren der Schulvorstand möglicherweise an die Dresdner Schulbankfabrik A. Lickroth & Cie. gewandt, deren Geschäftsempfehlung aus dem Jahr 1926 unsere Archivalie des Monats September ist.
Um 1910 war für die Ausstattung von Klassenzimmern vielfältiges Inventar zu beschaffen: Schulbänke unterschiedlicher Größe mit zwei oder vier Sitzen, ein Katheder mit Wandtafel für die Lehrkraft, Lese- und Rechenmaschinen, Schränke, ein Waschtischchen, Rahmen für Stundenpläne, Papierkörbe, Thermometer und stets auch ein Eimer mit Deckel. In den Jahren 1906 bis 1912 fertigte die Firma Lickroth unzählige Schulbänke für die Schule in Laubegast. Im Bestand des Stadtarchivs sind dazu neben Werbeprospekten mehrere Aufträge des Schulvorstands und Kostenanschläge der Firma überliefert. Für eine Schulbank waren ungefähr 16,50 Mark zu veranschlagen. Besonders bemerkenswert ist ein Großauftrag für die Lieferung von 110 Schulbänken, für die das Unternehmen eine Rechnung über 2.605 Mark ausstellte.
Die Ursprünge des Unternehmens A. Lickroth & Cie. lagen in Frankenthal in Rheinpfalz, einem bedeutenden Zentrum der Metallverarbeitung. Die Gründe, die Herrn Lickroth bewogen, beim Rat zu Dresden im Jahr 1885 den Antrag auf eine Gewerbeerlaubnis für eine Schulbankfabrik einzureichen, gehen aus seinem knapp formulierten Schreiben nicht hervor. Den Briefkopf schmückten die Abbildungen unzähliger Prämien, Medaillen und Auszeichnungen, die das Unternehmen bereits seit 1870 regelmäßig bei Messen und Ausstellungen gewonnen hatte.
Die Dresdner Niederlassung war erfolgreich, und im August 1897 beantragte A. Lickroth & Cie. eine Baugenehmigung für die Errichtung eines großen Fabrikgebäudes in der Bismarckstraße 57 in Niedersedlitz, mit zahlreichen Nebengelassen für Sägewerk und Schlosserei sowie Schuppen, Pferdeställe, Trockenkammer und Holzlager.
Die Firma A. Lickroth & Cie. stattete nicht nur Schulen aus, sondern sorgte auch für die gesamte Bestuhlung des 1926 eröffneten und im Zweiten Weltkrieg zerstörten Dresdner Planetariums. Das Fabrikgebäude in der Bismarckstraße 57 ist bis zum heutigen Tag erhalten, und die Möbelherstellung wurde dort viele Jahrzehnte lang weiterbetrieben.
Claudia Richert
Quelle: 17.4.1 Drucksammlung bis 1945, Nr. 277
August 2024
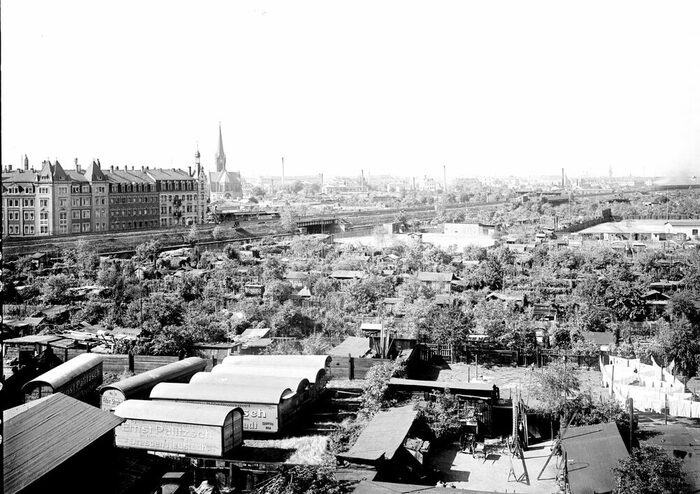
„von Kaninchen und Ziegen in der Budenstadt“. Schrebergärten in Dresden vor 1900
Im Juni 2024 wurde der Kleingartenverein „Dresden West“ im Stadtbezirk Cotta von der Stadt Dresden gemeinsam mit dem Stadtverband „Dresdner Gartenfreunde e.V.“ als schönste Anlage 2024 gekürt. Ziel dieses Wettbewerbs ist es, dass Kleingartenwesen als Dresdner Grün- und Freiraumsystem mit seinen sozialen, ökologischen und städtebaulichen Funktionen zu unterstützen. Anfang des 20. Jahrhunderts, im Jahr 1909, schrieb der „Verein zur Förderung Dresdens und des Fremdenverkehrs“ gemeinsam mit der Stadt Dresden das erste Preisausschreiben zur „Verbesserung und Verschönerung der Schrebergärten in Dresden“ aus. Es konnten sich ganze Gartenkolonien und einzelne Gärten dafür bewerben. Die Preisrichter interessierte vordergründig, wie die Gesamtanlage und die Lauben gestaltet wurden. Eine Bewertung über die Art der Bepflanzungen und vor allem die Art der Einfriedung folgte im zweiten Schritt. Der „Dresdner Anzeiger“ kommentierte diesen Wettbewerb als besonders notwendig, denn die meisten Gärten wurden vom Zeitungsblatt als „unordentliche Budenstadt“ beschrieben. Ein Jahr später forderten die Haus- und Grundstücksbesitzern die Stadt Dresden auf, ein „Verbot des Tierhaltens in den sogenannten Schrebergärten“ durchzusetzen. Von ungefähr 5056 Schrebergärten hielten ca. 1267 Gärten Tiere, die aus Sicht der Beschwerdeführer für eine massive Geruchs- und Lärmbelästigung verantwortlich waren. In einem Großteil der Schrebergärten konnten zeitweise Hühner, Tauben, Enten, Gänse, Kaninchen, Ziegen und sogar Schweine gehalten werden. Insbesondere für die von Armut betroffene Dresdner Bevölkerung galt sowohl die Tierhaltung als auch der Gemüse- und Obstanbau in den
Gärten als lebensnotwendig. Zu dem Zeitpunkt existierten in Dresden noch keine Vorschriften für Gartenkolonien. Hauptsächlich wurden diese auf privaten Boden und nicht auf städtischen Grundstücken angelegt. Erst im Jahr 1911 gründete sich zur Stärkung der Schrebergarten-Gemeinschaft der Verband „Dresdner Garten- und Schrebervereine“ in der sächsischen Metropole. Im Jahr 1919 beschloss die Deutsche Nationalverfassung die „Kleingarten- und Kleinpachtordnung“, die erstmals eine Rechtsgrundlage bezüglich der Schrebergärten schaffte und den Bau der städtischen Kleingartenkultur förderte.
Das erste Preisausschreiben für die schönste Gartenkolonie im Jahr 1909 gewann die Kolonie „Rudolphia“ an der Ecke Johann Meyer- und Buchenstraße mit 69 Gärten. Um weiterhin auf die Verschönerung und Verbesserung der Laubenkolonien hinzuführen, erfolgte in den darauffolgen Jahren ein jährlich ausgeschriebener Wettbewerb um die schönsten Schrebergärten in Dresden.
Annemarie Niering
Quelle: Stadtarchiv Dresden, 6.4.40.2 Stadtplanungsamt Bildstelle, VIII124, Fotograf unbekannt, um 1916.
Juli 2024
Vom Freibad zum Kulturdenkmal. Das Römische Bad von Schloss Albrechtsberg
Schloss Albrechtsberg - ehemaliger Wohnsitz Albrechts von Preußen - wurde 1854 umgeben von einem englischen Park und einem aufwendigen Terrassensystem fertiggestellt. Inspiration für den Architekten Adolf Lohse war die griechische und römische Antike sowie die italienische Renaissance. Obwohl die ursprüngliche Planung Lohses aus räumlichen und finanziellen Gründen nicht in ihrer Vollständigkeit umgesetzt werden konnte, blieb ein architektonisch bedeutender Bestandteil seines Konzepts bestehen: Zur Elbseite des Schlosses gelegen findet sich als Teil des Terrassensystems das Römische Bad von Schloss Albrechtsberg.
1925 ging das Grundstück in den Besitz der Stadt Dresden über, welche einige Jahre später den Park für die Allgemeinheit zugänglich machte. Bis in die 1950er Jahre erfreute sich die Parkanlage großer Beliebtheit. Dann jedoch fand sich ein anderer Nutzen für das Grundstück. Nach sowjetischem Vorbild wurden Gebäude und Außenanlagen zum Pionierpalast „Walter Ulbricht“ umfunktioniert – einem Freizeitzentrum für Kinder. In dieser Zeit wurde das Römische Bad sogar vorübergehend als öffentliches Bad genutzt.
Die Nutzung aber auch die Zeit selbst hinterließen ihre Spuren an der Konstruktion. Seit den 1950er Jahren wurden am Terrassensystem des Schlosses und am Römischen Bad selbst vermehrt Bau- und Restaurierungsarbeiten durchgeführt. Seit das Schloss, die Parkanlage sowie das Terrassensystem 1977 zum Denkmal von nationaler Bedeutung erklärt wurden, liegt der Fokus jedoch auf der Wiederherstellung und dem Erhalt der baulichen Struktur, da es sich um ein in Deutschland einzigartiges und architektonisch wertvolles Bauwerk sowie ein Kulturdenkmal handelt.
Derzeit wird dieses Bemühen fortgesetzt. Im Frühjahr 2023 wurde die Planung fundamentaler Instandsetzungsarbeiten am Römischen Bad aufgenommen und im März 2024 begannen die Baumaßnahmen. Das von Stadt, Land und Bund gemeinsam gestützte Projekt sieht eine Bauperiode von drei Jahren vor, die darauf abzielt, das Römische Bad in seiner historischen Form wiederherzustellen. Hierzu können alle interessierten Bürgerinnen und Bürger ihren Beitrag leisten. Der aktuelle Spendenaufruf der Stadt Dresden richtet sich an alle, die persönliche Erinnerungen mit dem Römischen Bad verbinden, die ein wertvolles Stück Dresdner Architektur erhalten sehen wollen und den kulturellen Wert eines geschichtsträchtigen Bauwerks zu schätzen wissen.
Theresa Jäger
Quelle: Stadtarchiv Dresden, 12.10.17 Präsentationsmappen Sächsischer Architekten, Nr. 109
Juni 2024
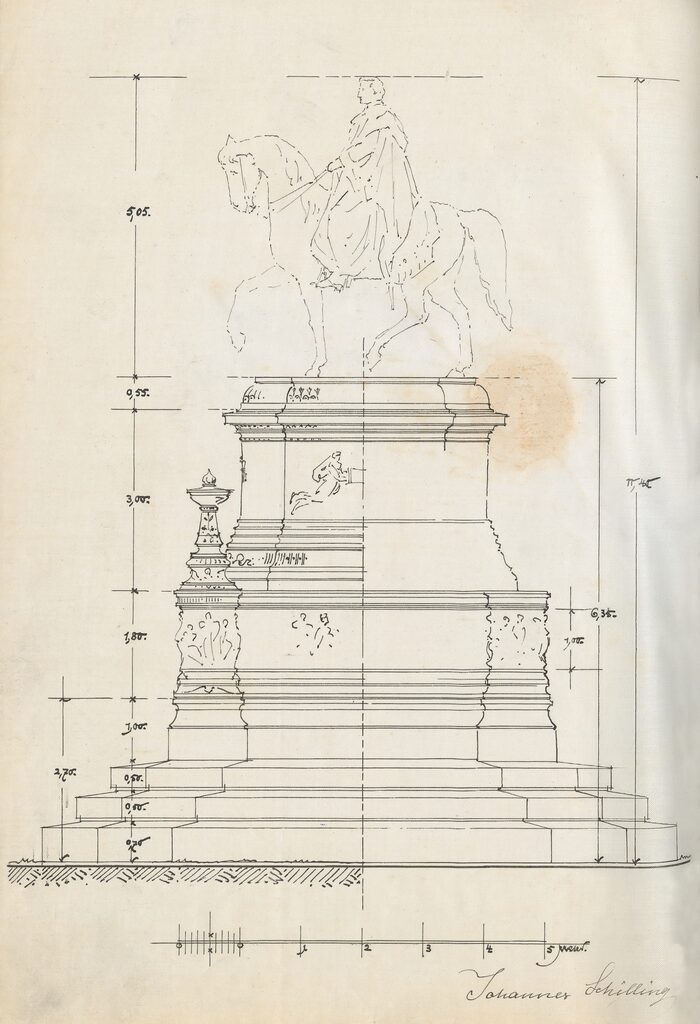
Ein Denkmal für die Ewigkeit. Das König-Johann-Denkmal auf dem Theaterplatz
Den ab 1840 neu gestalteten Theaterplatz sollte mittig ein Denkmal schmücken. Zunächst kam die Idee auf, das Ehrenmal von König Friedrich August I. aus dem Zwingerhof auf den Platz vor die Semperoper umzusetzen. Dies stieß jedoch auf Widerstand und der Platz blieb einige Zeit leer. Erst nach der Neuerrichtung der Semperoper wurde der Gedanke wieder aufgegriffen. Dieses Mal fiel die Wahl auf den sächsischen König Johann (1801–1873). Für ein solches Projekt waren jedoch Gelder nötig – genauer gesagt 286.000 Mark. Dem Aufruf des Landescomités für das König-Johann-Denkmal, vertreten durch den Oberbürgermeister Dr. Alfred Stübel, zum Sammeln von Spenden für die Errichtung des besagten Denkmals im Jahr 1881 folgten viele Bürger und Bürgerinnen Dresdens und Sachsens. Anfänglich fielen die Geldzuwendungen eher gering aus. Doch nach einer Zugabe des Sächsischen Finanzministeriums konnte schließlich 1884 ein Vertrag zwischen dem Bildhauer Prof. Dr. Johannes Schilling und dem Landescomité geschlossen werden. Schilling schlug ein sechs Meter hohes Reiterstandbild aus Bronze vor, das auf einem Sockel stehen sollte. Er verpflichtete sich vertraglich, innerhalb von drei Jahren alle Zeichnungen sowie architektonischen und figuralen Modelle aus Bronze zu liefern sowie die Leitung und Überwachung der Arbeiten zur Anfertigung und Aufstellung zu übernehmen. Da er jedoch erst 1888 fertig wurde und sich verschiedene Änderungen der Maße ergeben hatten, beauftragte man die Dresdner Architekten Karl Weißbach und Karl Barth mit der Fertigstellung der Basis nach den Zeichnungen Schillings. Eine dieser Skizzen ist unsere Archivalie des Monats, die im Juni im Lesesaal des Stadtarchivs Dresden, Elisabeth-Boer-Straße 1, mit einigen anderen Unterlagen zu sehen ist.
Am 18. Juni 1889 fand im Rahmen der 800-Jahr-Feier der Wettiner die Enthüllung des König-Johann-Denkmals statt. Im Festprogramm, welches das Stadtarchiv ebenfalls aufbewahrt, wird der Beginn »gemäß Allerhöchsten Befehles um 3 Uhr Nachmittag« angekündigt. Nach einem Festgesang und einer Rede von Oberbürgermeister Dr. Stübel wurde unter Ehrenerweisung der aufgestellten Ehrencompagnie des I. (Leib-)Grenadierregiments, Glockengeläut und dem Salut der am rechten Elbufer aufgestellten Batterie (101 Schuss) das Denkmal enthüllt. Als erstes durften die »Allerhöchsten und Höchsten Herrschaften« das Monument zur Besichtigung umrunden. Der Festplatz blieb vom Museum bis zum Schloss und der Katholischen Hofkirche während der Zeremonie für den allgemeinen Verkehr gesperrt. Zutritt über die Ostraallee durch den Zwinger erhielten nur Ausgewählte mit einer Eintrittskarte. Der nördliche Teil des Theaterplatzes blieb offen.
Das Ehrenmal überstand einige kritische Zeiten wie die Bronzesammelaktionen im Zweiten Weltkrieg und die Bombenangriffe im Februar 1945. Als Übersetzer von Dantes „Göttliche Komödie“ genoss der sächsische König eine hohe künstlerische Anerkennung, die seine Gedenkstätte vor dem Abbau in der DDR bewahrte. So thront er seit bereits 135 Jahren nahezu unbeschadet und seit 2013 saniert in der Mitte des Theaterplatzes.
Susanne Koch
Quelle: Stadtarchiv Dresden, 2.1.6 Ratsarchiv, Hauptgruppe G, Nr. G.XXXV.b.18 Bd. 5
Mai 2024
Wertschätzung und Gedenken an die Flammen. Der Tag des (freien) Buches im Lauf der Geschichte
In Deutschland erstmals 1929 abgehalten, wurden Jahrestage im Zeichen des Buches in den vergangenen 100 Jahren nicht nur an mehreren Daten im Kalender, sondern auch unter ganz verschiedenen Anzeichen durchgeführt.
Im Jahr 1929 wurde der erste „Tag des Buches“ durch den Börsenverein der Deutschen Buchhändler initiiert. Nach dem Vorbild Spaniens, wo diese Veranstaltung an Cervantes‘ Geburtstag stattfand, wählte man Goethes Todestag aus. Der Tag des Buches sollte durch Vorträge, Ausstellungen und Veranstaltungen die Situation „des guten Buches“ in der Öffentlichkeit darstellen und dem Buch als „vornehmsten Mittler deutschen Geistesgutes“ nicht nur wieder „die ihm gebührende Verbreitung und Wertschätzung in allen Volkskreisen“ verschaffen, sondern auch „unerfreulichen Anzeichen zunehmender Entgeistigung und Verflachung“ entgegentreten.
Während die zentrale Veranstaltung in Berlin erfolgte, wurden daneben örtliche Kundgebungen ins Leben gerufen, die „die Bewegung […] bis in die kleinste Gemeinde“ trugen. Im Dresdner Schulamt sprachen Vertreter des Arbeitsausschusses für Sachsen vor und baten um Überlassung des Festsaales im Neuen Rathaus sowie einen Zuschuss in Höhe von 800 RM zur Deckung der Unkosten für die am Abend des 22. März geplante Feier. Der Nutzung des Festsaales wurde zugestimmt und ein Zuschuss in Aussicht gestellt. Zahlreiche Redner wurden gewonnen zu Themen wie etwa Buch und Jugend, Buch und arbeitendes Volk, Buch und Presse. Künstlerische Darbietungen Erich Pontos sowie der Orchesterschule umrahmten die Feier. Zu der Veranstaltung sollte jedermann freien Eintritt erhalten. Wie der Dresdner Anzeiger am nächsten Tag berichtete, war der Festsaal schon lange vor der festgesetzten Zeit überfüllt, und obwohl auch noch die Nachbarräume geöffnet wurden, mussten zahlreiche Kommende unverrichteter Dinge wieder heimkehren.
Nur vier Jahre später, am 10. Mai 1933, wurden Bücher nicht länger gewürdigt, sondern öffentlich verbrannt. Dieses Ereignis prägte die Geschichte nachhaltig. Bereits im Jahr darauf begründete der Schriftsteller Alfred Kantorowicz gemeinsam mit anderen deutschen Autoren am 10. Mai 1934 in Paris eine Bibliothek der verbrannten Bücher, die so genannte Deutsche Freiheitsbibliothek. Im Jahr 1947 proklamierten Vertreter aller vier Besatzungsmächte den 10. Mai zum „Tag des Freien Buches“. Durch die Ereignisse des Kalten Krieges verlor das gemeinsame Gedenken jedoch an Bedeutung. Nur in der DDR blieb dieser Gedenktag bis zum Schluss erhalten. Seit 1995 findet immer am 23. April der Welttag des Buches statt.
Claudia Richert
Quellen: 17.2.17 Sammlung Manfred Lotze, Sign. 577; 2.3.1 Hauptkanzlei, Sign. 2
April 2024
Klöppeln, weben und Teppich knüpfen. Die Textilausstellung 1924 in Dresden
Vor fast genau 100 Jahren öffnete am 31. Mai 1924 die „3. Jahresschau Deutscher Arbeit“ auf dem Ausstellungsgelände an der Lennéstraße ihre Pforten. Die Ausstellung widmete sich mit der Textilbranche einem für Sachsen wichtigen Wirtschaftszweig. Für die Besucher, egal ob Laie oder Textilfachkundiger, gab es mehrere thematische Bereiche für den Rundgang. Zu Beginn erwartete die Gäste ein Überblick über die geschichtliche Entwicklung der Textilherstellung und daran anschließend konnte man sich über Bekleidungstextilien informieren. In dieser Halle der Textilstoffe erhielten die Besucher einen Eindruck von der Verarbeitung des Rohgarns bis zum Kleiderstoff, Teppich oder Kunststickerei.
Als weiteren Themenschwerpunkt wurden die gegenwärtigen Fabrikationszweige gezeigt und die technischen Neuerungen bei der Maschinenproduktion besprochen. In diesen Hallen ging es vornehmlich um die Textilveredelung, wie Bleichen, Färben und Bedrucken. Hier stand der Veredelungsprozess im Vordergrund, der entweder mitten im Herstellungsprozess oder nach der Vollendung einsetzte. Die Herstellung von Fasern aus chemischer Erzeugung erlangte auf der Ausstellung großen Zuspruch. Einen ebenso bleibenden Eindruck hinterließ die „schöne Ausstellung der Firmen des Oberlausitzer Webereiverbandes“ wie auch die Klöpplerinnen in der Erzgebirgischen Klöppelstube.
144 Aussteller, wovon 101 aus Sachsen kamen, zeigten ihre Produkte oder Fertigkeiten dem interessierten Publikum. Im Zeitraum von Juni bis September zählten die Veranstalter circa 750.000 Besucher auf dem Ausstellungsgelände. Sogar Reichspräsident Friedrich Ebert stattete der Textilausstellung seinen Besuch ab, als er in Dresden war. Die Textilausstellung im Frühjahr 1925 wurde im Nachgang als großer Erfolg gefeiert.
Marco Iwanzeck
Quelle: Stadtarchiv Dresden, 18 Bibliothek, Hist. Dresd. 2295.
März 2024
Landwirtschaftlicher Großhandel in Dresden. Die Großmarkthalle in der Friedrichstadt
Lebensmittelmärkte wurden lange Zeit im Freien abgehalten. Im 18. Jahrhundert entstanden vermehrt Markthallen, um witterungsbedingte, den Handel hemmende Einflüsse auszuschließen sowie aus hygienischen Gründen. Außerdem musste man zunehmend den Bedürfnissen der schnell wachsenden Stadt gerecht werden.
In Dresden geschah das Ende des 19. Jahrhunderts, als 1888 ein von den städtischen „Körperschaften“ gefasster Beschluss die Errichtung von insgesamt drei großflächigen Markthallen vorsah: eine für den Großhandel und zwei für den Kleinhandel, eine links-, die andere rechtselbisch. Schließlich wurde am 15. Juli 1893 die Halle auf dem Antonsplatz eröffnet. Am 9. Dezember 1893 begann die Großmarkthalle, auch Hauptmarkthalle genannt, an der Weißeritzstraße und am 7. Oktober 1899 die Neustädter Markthalle mit dem Verkauf. Mit deren Etablierung ging die Einstellung der bis dahin üblichen offenen Wochenmärkte auf dem Antonsplatz, dem Altmarkt sowie dem Neustädter Markt einher. Einzig derjenige auf dem Hohlbeinplatz verblieb.
Das repräsentative Gebäude der Hauptmarkthalle mit ihrem 30 Meter hohen Uhrturm, teilweise errichtet über dem zwischen 1891 und 1893 verlegten Flussbett der Weißeritz, war technisch auf dem neuesten Stand. Im Inneren des unterkellerten und über eine Galerie verfügenden Baus gab es beispielsweise elektrische Lastenaufzüge sowie eine moderne Kühl- und Gefrieranlage. Durch das Mittelschiff verlief eine Hauptdurchfahrtsstraße für Lastfuhrwerke. Den logistisch wohl größten Nutzen brachte der Gleisanschluss mit Laderampe und Güterboden. So konnten Eisenbahnwagons zügig entladen und die landwirtschaftlichen Produkte in der Halle eingelagert oder sogleich in Güterstaßenbahnwagen verladen werden. Gehandelt wurden im großen Maßstab landwirtschaftliche Erzeugnisse wie Fleisch, Fisch, Grünwaren, Obst, Blumen, Butter, Eier und Kartoffeln. Auf der sogenannten „Insel“ vor der Markthalle, entlang der Weißeritzstraße drängten sich derweil die vielen Klein- und Zwischenhändler, die dafür sorgten, dass die Waren den Einzelhandel und die Gastronomie erreichten.
Die teilweise Zerstörung der Markthalle im Jahr 1945 führte zu großen Problemen. Besonders die Wiederherstellung der Dachkonstruktion, der Kühl- und Gefrieranlagen, der Aufzüge und der Verglasung dauerte mehrere Jahre. Aber schon im September 1945 war es gelungen, den Großmarkt provisorisch wieder in Gang zu bringen. Die Bedeutung der Großhandelshalle blieb bis zum Ende der DDR bestehen, täglich wurden hier Züge entladen. Seit 1990 werden in ihr keine Lebensmittel mehr gehandelt.
Patrick Maslowski
Quelle: Stadtarchiv Dresden, 17.6.1 Ansichtskarten, Nr. SH 014.
Februar 2024
„Die Leipzig-Dresdner-Eisenbahn“. Ein Wochenblatt zwischen Technikbegeisterung und -skepsis.
Die öffentliche Aufmerksamkeit, welche die im Jahre 1839 eröffnete erste europäische Ferneisenbahnlinie zwischen Dresden und Leipzig erregte, muss enorm gewesen sein. Nicht nur die einschlägige Reiseliteratur rückte die entstandenen Bahnhofsanlagen rasch unter die Top-Fünf der Dresdner Sehenswürdigkeiten. Auch das sich seinerzeit ausdifferenzierende lokale und überregionale Pressewesen fand hierin seit der Projektierungsphase und bis in die ersten Betriebsjahre hinein ein wachsendes Lesepublikum. Dieses räsonierte mitunter euphorisch über die humanen Fortschrittsmöglichkeiten der Dampfeisenbahn. Es beklagte teils das nahe Ende ruhiger, beschaulicher Lebenswelten oder mahnte gar vor einem möglichen Missbrauch nunmehr entfesselter technischer Potentiale. Zum breiten öffentlichen Diskurs gesellten sich literarische, poetische und satirische Reflektionen zum „eisernen Dampfross“ als neuen Fortschrittssymbol.
Der mediale Markt begann bald auf diesen geschäftsförderlichen Trend zu reagieren. Journalisten befeuerten ihn mit Inhalten und Verleger begannen thematisch spezialisierte Zeitschriften herauszugeben. Neben der „Erzgebirgischen“ und der „Pönickischen Eisenbahn“, erschienen Blätter mit dem Titel „Dampfwagen“ oder „Komet“ - nach einer seinerzeit populären Leipziger Lokomotive.
Die von 1839 bis 1843 beim Leipziger Verleger und Redakteur N. Büchner erscheinende „Leipzig-Dresdner-Eisenbahn“ trug den Untertitel „Ein Wochenblatt für Deutschland“ und spielte auch in ihrer inhaltlichen Strukturierung humorvoll mit Eisenbahnmetaphorik. Dabei hielten sich unterhaltsame, intelligente und nachdenkliche Stimmen durchaus die Waage. Mit kritischen Tönen wurden etwa die miserablen bis gefährlichen Reisebedingungen für die ärmsten Bevölkerungsteile in offenen „Kälberwagen“ kommentiert, das Einziehen der Pässe vor Fahrtantritt oder das Abschließen der Wagons. Daneben wurden Vorschläge für mehr Betriebssicherheit diskutiert.
Besonders beflügelte die neue Bahntechnik weitere Fortschrittsphantasien darüber, wie Maschinen die Welt künftig weiter verändern könnten. In der Ausgabe vom 17. November 1841 formulierte ein Beitrag Gedanken, die man aus heutiger Sicht durchaus als hellsichtig bezeichnen könnte: Die Erfindung der Eisenbahn verkleinere die Erde. Geografie könne man nunmehr nicht nur aus Büchern, sondern zugleich auch Vor-Ort studieren. Maschinen könnten Tag und Nacht für die Menschen arbeiten, ganze Städte in Kürze erbauen, Häuser in einem Guss erstellen sowie fertig gedruckte Bücher und Zeitungen hervorbringen, Briefe und Buchführungen automatisiert erledigen, die Felder von selbst pflügen und den Menschen „Engeln gleich“ das Fliegen ermöglichen. Dass sich mit dem Fortschrittssymbol Eisenbahn bald auch sprichwörtliche „Höllenfahrten“ planen und durchführen ließen, zeichnete sich schon früh nach deren Erfindung ab. Bereits 1842, nur wenige Jahre nach Eröffnung der Strecke, erschienen erste militärstrategische Publikationen, wie etwa „Die Eisenbahnen und ihre Bedeutung als militärische Operationslinien“ von Karl Eduard Poenitz. Dessen Theorien sollten schon 1849 praxisrelevant werden, als es galt, Preußische Truppenverstärkung zur Niederschlagung des Maiaufstandes zügig nach Dresden zu mobilisieren. Gut einhundert Jahre später war die Eisenbahn, einstige Hoffnungsträgerin menschlichen Fortschritts, auch zu einem zentralen Instrument nicht nur militärischer Truppen- und Rüstungsgüterbewegungen zweier Weltkriege geworden. Sie bildete auch die Infrastruktur für die Planung und Umsetzung der massenhaften Vertreibungen, Deportationen und Vernichtungen von Menschen im 20. Jahrhundert.
Dr. Stefan Dornheim
Quelle: Stadtarchiv Dresden, Bestand Bibliothek/Zeitungen Z. 272
Januar 2024
Das fröhlich frische Wintervergnügen
Sobald die ersten Schneeflocken fallen und liegen bleiben, ziehen Kinder wie Erwachsene auf die Rodelhänge, um mit ihren Schlitten die Hänge herunterzufahren. Das winterliche Rodeln ist nach wie vor ein sehr beliebtes Freizeitvergnügen. Auch der professionelle Rodelsport erfreut sich großer Beliebtheit. Am Ende des 19. Jahrhunderts war das Rodeln noch das bescheidene Wintervergnügen der Alpenbewohner. Doch schon wenige Jahre nach der Jahrhundertwende trat der Rodelsport einen wahren Siegeszug an. Dies lag wohl vor allem daran, dass kein anderer Sport so leicht erlernbar war und gleichzeitig so viel Freude bereitete. Man benötigte nur das richtige Equipment.
Auf diesen Winterspaß hatte sich in Dresden ganz besonders das Kaufhaus Hermann Mühlberg eingestellt und gab für die kalte Jahreszeit einen eigenen Katalog für Wintersport und Touristik heraus. Somit konnten die Dresdnerinnen und Dresdner alles Notwendige für ihre Freizeitgestaltung besorgen. Auf zwölf Katalogseiten wurden die verschiedensten Schlitten, Rodel, Bobsleighs und Skeletons angeboten. Der größte Teil des Sortiments umfassten die typischen Rodel, die auch heute noch sehr beliebt sind. Die Davoser-, Tiroler- oder Alpenrodel gab es in unterschiedlichen Varianten und Preisklassen. Es gab Holz- oder Stahlrohrschlitten in der Ausführung mit ein, zwei oder drei Sitzen. Das Kaufhaus hielt aber auch Sondervarianten vor. Einige Modelle besaßen eine Klappfunktion, um den Rodel auf dem Rücken tragen zu können. Andere waren mit einem Lenkrad wie bei einem Automobil ausgestattet.
Da das Rodeln noch eine junge Sportart war, gab es im Katalog auch eine Handlungsanweisung für unerfahrene Piloten, denn eine gewisse Technik ist unerlässlich. So sollten die ersten Versuche bei höchstens zehn Prozent Gefälle und wenig Kurven ausgeführt werden. Die richtige Sitzposition, also weit hinten sitzen, den Oberkörper zurückneigen und die Füße fest anlegen, sei einzuhalten. Mit den Füßen wird gelenkt und gebremst, wobei der Bremsvorgang durch das Hochreißen des Schlittens unterstützt wird. Als Sicherheitshinweis galt, dass bei einem eigenen Sturz die Bahn schnellstens mit dem Rodel verlassen wird. Dahingehend hat sich bis heute wenig geändert.
Marco Iwanzeck
Quelle: Stadtarchiv Dresden, 17.4.1 Drucksammlung, Nr. 278/2
Archivalien des Monats aus dem Jahr 2023
Dezember 2023

Von der Stadtbilddokumentation zur Stadtbildfotografie
Vor fast genau 200 Jahren reifte im Zuge der Entfestigung der Residenzstadt Dresden erstmals die Idee einer umfassenden und systematischen Dokumentation des architektonischen Stadtbilds. Die massiven Veränderungen in Gestalt und Struktur der Stadt blieben den Zeitgenossen nicht verborgen. Aus privater Motivation heraus entwickelte der evangelische Hofkirchenorganist Friedrich Georg Kirsten die Idee, das äußere Bild Dresden aus der Zeit vor der Entfestigung für die Zukunft zu bewahren. Zwischen 1821 und 1825 ließ Kirsten die Festungswerke in der Gestalt, die sie bis zu ihrer im Jahr 1811 begonnen Abtragung gehabt haben, abbilden. Dafür beauftrage er den Landschaftsmaler Friedrich August Kannegießer, der 90 farbige Ansichten anfertigte. Dabei griff er auf Vorarbeiten unterschiedlicher Maler zurück, die sie teils schon lange vor dem Jahre 1811, teils kurz vor dem Beginn der Entfestigung entworfen hatten. Kirsten und Kannegießer schufen Abbildungen der Stadt, die sich bis heute erhalten haben.
Dieser ersten systematischen Stadtbilddokumentation folgten im Laufe der vergangenen 200 Jahre weitere Überlieferungen des Stadtbilds, die wiederum zum größten Teil mit dem Fotoapparat gemacht wurden. Anknüpfend an die rund 200-jährige Tradition der Stadtbilddokumentation in Dresden, begann das Stadtarchiv im Jahr 2020 mit der Konzipierung des Projektes „Stadtbildfotografie“. Ziel war es, eine ganzheitliche, fotodokumentarische und anspruchsvolle Stadtbildfotografie zu schaffen. Kooperationspartner waren die Stadtbezirksämter, die das Vorhaben unterstützten. Das Projekt endete 2023 mit der Übergabe von 8.043 Fotos durch den Fotografen Albrecht Voß. Ab dem 4. Dezember 2023, nachdem die Fachausstellung zur Stadtbildfotografie im Stadtarchiv eröffnet wurde, stehen die Fotos der Öffentlichkeit frei und digital zu Verfügung. Die Ausstellung im Stadtarchiv zeigt zum einen den historischen Kontext der Stadtbilddokumentation und zum anderen eine Auswahl an Fotografien von Albrecht Voß, die in den Dresdner Stadtbezirken entstanden.
Marco Iwanzeck
Quelle: Stadtarchiv Dresden, 18. Bibliothek, Hist.Dresd. 3120
November 2023
Das Orpheum – ein fast vergessener Ort einstigen Vergnügens
In der kalten Jahreszeit ändern sich für ein paar Monate Lebensweisen, Freizeitverhalten und Kulturangebote. Es findet zwangsläufig wieder mehr drinnen statt, heute wie damals. Beispielsweise öffnen sich die Türen der großen Theater, der Opern- und Ballhäuser. Letztere boten und bieten zwar das ganze Jahr über Veranstaltungen an, Ballsaison war jedoch im Winter, im Januar und Februar. Ein solches Ballhaus war das Orpheum. Bis heute verbirgt es sich hinter der unscheinbaren Wohnhausfassade der Kamenzer Straße 19 und ist zugleich einer der ältesten Vergnügungsorte der Äußeren Neustadt. Es war aber nur eines von circa 150 Ballhäusern in Dresden während ihrer Blütezeit um 1900.
Generell hatten Tanzveranstaltungen, je nachdem, in welchem sozialen Milieu sie stattfanden, unterschiedliche Bedeutung. Während derlei Ereignisse in der gehobenen Gesellschaft (Hof und Großbürgertum) zur Repräsentation oder mitunter als Heiratsmärkte dienten, suchten die einfachen Leute (Kleinbürgertum und Proletariat) vornehmlich Ablenkung vom monotonen, fremdbestimmten Arbeitsalltag oder auch nur einen kleinen Rausch im scheinbar trostlosen Leben. Daneben lockte die freie Partnerwahl in der anonymen Großstadt im Gegensatz zur strengen Sitte und sozialen Kontrolle der Kleinstadt oder des Dorfes, von wo aus viele Menschen in die Stadt zogen.
Das zu Feierlichkeiten stets prächtig geschmückte Orpheum, was im Übrigen Konzertsaal oder Tonhalle bedeutet und nach Orpheus, dem namhaften Sänger aus der griechischen Mythologie, benannt ist, wurde 1883 fertiggestellt. Die wundervollen, stilgebenden Innenausbauten existieren immer noch und vermitteln eine Atmosphäre längst vergangener Zeiten: die gusseisernen Säulen, die beidseitig begehbaren Wendeltreppen, die reihumlaufende Empore, die große Gewölbedecke mit Oberlicht, Stuckelementen und einigen, allerdings nicht mehr allen der früheren Malereien. Einzig die Bühne, auf der die Kapelle einst aufspielte, wich im Zuge der Restaurierung 1998 einer Glasfront.
Als Tanzstätte und Konzertsaal wurde das Orpheum bis 1932 genutzt. Danach beherbergte es von 1936 bis 1996 die Flügel- und Pianofabrik Thierbach. Es folgten die Versuche, ein Varieté zu etablieren sowie die Fremdnutzung des Saales als Bürofläche und am Ende der Leerstand. Eine dem Saal angemessene Nutzung bleibt bis heute aus.
Patrick Maslowski
Quelle: Stadtarchiv Dresden, 17.6.1 Ansichtskarten, Nr. GH 268
Oktober 2023

„Anormale Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen“ Die Brachlandaktion im Großen Garten
Eine Fotografie aus dem Jahr 1948 zeigt eine ungewöhnliche Lösung, mit der man dem Hunger der unmittelbaren Nachkriegszeit in Dresden begegnete. Weitere Fotos dazu werden im Lesesaal des Stadtarchivs in der Elisabeth-Boer-Straße 1 im Monat Oktober ausgestellt.
Wo heute die Dresdnerinnen und Dresdner im Großen Garten flanieren, war die Fläche in den ersten Nachkriegsjahren einer anderen Verwendung als der Erholung zugeführt worden – sie diente als Grabeland. Um dem Hunger in der Stadt entgegenzuwirken, rief Oberbürgermeister Rudolf Friedrichs bereits am 30. Mai 1945 dazu auf, alles verfügbare Land mit Kartoffeln, Kohl und Gemüse zu bebauen. In der daraus hervorgehenden Brachlandaktion setzte sich die Stadtverwaltung dafür ein, das Brachland im Stadtgebiet zu Grabeland umzuwandeln. Rasch wurden dafür die städtischen Parkanlagen in den Blick genommen. Am 12. August 1945 wandte sich ein Bürger mit dem Vorschlag an die sächsische Landesverwaltung, ihm eine Fläche im Großen Garten zur Nutzung als Hühner- und Geflügelfarm zu verpachten, da „anormale Zeiten außergewöhnliche Maßnahmen“ erfordern würden. Zwar kam es nicht dazu, doch bereitete das Gartenamt den Großen Garten im Sinne der Brachlandaktion vor.
In ersten Arbeitseinsätzen begann das Gartenamt, die Kriegsschäden zu beseitigen. Zudem wurde der Große Garten von der Roten Armee als Weideland für Großvieh verwendet, für die zunächst Ersatzland gesucht werden musste. Schließlich verpachte das Gartenamt das Land im Großen Garten als Grabeland an Bürger. Die dafür nicht geeigneten Wiesenflächen wurden zur Tierhaltung genutzt. Das Gartenamt zeigte sich mit den getroffenen Maßnahmen am 25. Mail 1946 zufrieden, da durch Grabeland und Weideland „eine völlige Ausnützung des Geländes vorgenommen worden ist, die der Stadt Dresden außerdem noch einen Pachtertrag von RM 1.300.- einbrachte.“ 1948 gab es vor dem Palais 69 Parzellen, die zwischen 25 Quadratmeter und 300 Quadratmeter groß waren - insgesamt eine Fläche von 12.370 Quadratmetern. Das Grabeland war als ein Provisorium zur unmittelbaren Notlinderung der Bevölkerung geplant: Angepflanzt werden durften nur einjährige Pflanzen, das Gelände durfte nicht durch Abgrabungen und Aufschüttungen verändert werden, Baulichkeiten waren zu unterlassen.
Am 12. September 1949 fand dieses Provisorium ein Ende und der Stadtrat beschloss unter anderem die Aufkündigung des Grabelandes im Großen Garten. Begründet wurde das damit, dass aufgrund der Verbesserung der Lebenshaltung Brachland weniger benötigt wurde. Stattdessen strebte man an, die öffentlichen Grünflächen wieder zu „Schmuckflächen für die Stadt und Erholungsanlagen“ umzugestalten. 1950 wurde das Grabeland zurückgebaut, wobei die Parzellenbesitzer auf Wunsch Ersatzland erhielten und die Grünflächen wiederhergestellt. Bald konnten die Dresdnerinnen und Dresdner den Großen Garten erneut als Erholungsort nutzen.
Deborah Rohne
Quelle: Stadtarchiv Dresden, 9.1.5 VEB (ST) Günanlagen Dresden, Nr. 1212.
September 2023
Das Fischhaus. Ein Schlüsselort der frühen Dresdner Umweltgeschichte
Am nordöstlichen Ende der Radeberger Vorstadt, dort wo die gleichnamige Landstraße in die Heide eintritt, befindet sich das Dresdner Fischhaus. Mit den frischen Quellwasservorkommen der nahegelegenen drei Eisenbornquellen sowie der Tannenbornquelle verbinden sich die mittelalterlichen Anfänge der Dresdner Trinkwasserversorgung. Die Landesherren Ernst und Albrecht von Sachsen hatten 1476 den Augustinermönchen zu Altendresden erlaubt, eine Röhrwasserleitung zur Stadt anzulegen, welche mit ihren späteren Erweiterungen über 400 Jahre hinweg bis 1875 die Neustadt mit Trinkwasser versorgte und erst um 1895 durch das Wasserwerk Saloppe vollständig ersetzt wurde. Mit dem Bau des Jägerhofes in Dresden verlegte man 1568 eine zweite Leitung, welche ihr Wasser ebenfalls hinter dem Fischhaus entnahm. Das Wasserwesen regelte die Dresdner Wasserordnung vom 3. Juni 1590. Ein sogenannter Röhrmeister beaufsichtigte die Leitung, Reinhaltung und Verteilung des Wassers. Das Anwachsen der Neustadt im 17. und 18. Jahrhundert erhöhte auch den Wasserverbrauch, sodass am Fischhaus als Verteiler ein ca. 3 Meter langer Wassertrog angelegt wurde, welcher 1729 bereits vier Ausgänge aufwies: für das alte Stadtwasser, das neue Stadtwasser, für das Fischhauswasser sowie für das Jägerhauswasser. Die hölzerne Rinnenleitung bestand aus ausgehöhlten und mit Holz bedeckten Eichenstämmen. Die Wasserverteilung innerhalb der Neustadt erfolgte seit dem 18. Jahrhundert über Zacharias Longuelunes repräsentative Wasserhäuser entlang der Hauptstraße, welche 1895 entfernt wurden.
Seit der Zeit um 1572 verwendete Kurfürst August I. besondere Aufmerksamkeit auf die Fischerei seines Landes und der Residenz Dresden und ließ am Fischhaus Fischbecken anlegen, denen in späterer Zeit weitere folgten. Zur Hälterung in frischem Quellwasser kamen um 1577 die Fische aus den einst sieben Teichen des gesamten Heidegebietes. Dazu kamen zwei größere Teichanlagen am Fischhaus, die sogenannten Fischmannsteiche. Alle Teiche unterstanden einem Fischmeister, der sie nur alle 14 Tage befischen lassen durfte. Die Fänge gelangten in die Fischhälter am Fischhaus sowie in diejenigen der Stadt Dresden, welche sich im 16. Jahrhundert am alten Jägerhaus an der Weißeritz vorm Wilsdruffer Tor, im 17. Jahrhundert dann zwischen Palmstraße und Fischhofsplatz befanden und von da schließlich in die Hofküche oder auf den Markt.
Das seit Mitte des 16. Jahrhunderts bestehende Teichwärterhaus, welches seit dem frühen 17. Jahrhundert zugleich auch als Forsthaus des sog. „Fischhäuser Reviers“ diente, gilt nachweislich als eines der ältesten, kontinuierlich bis zur Gegenwart bewirtschafteten Gasthäuser der Stadt Dresden. Um 1650 erhielt das Haus die Schank- und Gastgerechtigkeit verliehen. Als Rast und Ausspanne vor und nach langer Walddurchquerung wurde es an der Radeberger Landstraße zu einer wichtigen Station für Reisende und Fuhrleute. Seit dem 19. Jahrhundert wurde das Fischhaus zunehmend als Sommerfrische für die Bewohner der sich industrialisierenden Großstadt von Bedeutung – und ist es noch heute.
Als gastronomischer Ort mit regem Publikumsverkehr in dem für die städtische Naherholung und Naturbildung wichtigen Gebiet der Dresdner Heide bildet die historische Topografie um das Fischhaus einen bedeutsamen Erinnerungs- und Lernort zur langen Geschichte der Dresdner Stadt-Natur-Beziehungen.
Dr. Stefan Dornheim
Quelle: Stadtarchiv Dresden, Ratsarchiv 2.1.5. F.X. 205d, Die Anno 1590 errichtete Wasserordnung und der Gewerken Vergleich, 1590 ff.
August 2023

Die heimatgeschichtliche Sammlung des Oberlehrers Ernst Karl Rühle aus Leubnitz-Neuostra. Fossilien und andere archäologische Funde im Stadtarchiv Dresden
Vor zehn Jahren wurde dem Stadtarchiv Dresden eine Sammlung übergeben, die neben den üblichen Unterlagen eines Ortschronisten auch eine umfangreiche archäologische Sammlung enthält. Etwa 300 Objekte aus den unterschiedlichsten Gebieten Deutschlands befinden sich seitdem in unserem Archiv. Die schönsten Fundstücke bilden zusammen unser Archivale des Monats August und sind im Lesesaal des Stadtarchivs Dresden, Elisabeth-Boer-Straße 1, ausgestellt.
Der Begründer der historischen Sammlung, Ernst Karl Rühle, war Oberlehrer an der 68. Volksschule in Leubnitz-Neuostra. Zusammen mit seinem Kollegen Max Löffler eröffnete er in den Räumen des Schulgebäudes im Jahr 1936 eine Heimatsammlung. Nach circa 20 Jahren war dort allerdings Schluss. Er musste die Schulzimmer räumen. So kam es, dass er gemeinsam mit einigen Schülern und einem Leiterwagen die gesamte Ansammlung heimatgeschichtlicher Forschungen in sein Haus in Leubnitz-Neuostra brachte und dort bewahrte. Einer seiner Lieblingsschüler, Herr Janello, dessen Interesse an Naturwissenschaften durch Rühle geweckt wurde, zog später mit seiner Familie in das Haus Rühles und erbte damit ebenso das Ortsarchiv. Er beschäftigte sich arbeitsbedingt unter anderem mit Museumsfragen und dem Sächsischen Archivgesetz. Dieses Zusammenspiel brachte Herrn Janello schließlich dazu, die Sammlung dem Stadtarchiv zu übergeben, um eine fachliche Lagerung zu gewähren und die Heimatgeschichte der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Auf dem nebenstehenden Bild ist ein kleiner Auszug des archäologischen Sammlungsteils zu sehen. Das gut erhaltene Fossil eines Perisphinctes Tiziana gehört zur ausgestorbenen Gattung der Ammoniten-Kopffüßer und lebte im mittleren bis späten Jura. In der fast quadratischen Steinplatte aus Württemberg sind mehrere kleine Ammoniten für die Ewigkeit konserviert.
Der circa sechs Zentimeter große Zahn eines Carcharodon megalodon lässt vermuten, welche gigantischen Ausmaße dieser Urzeithai erreichen konnte. Schätzungen gehen von einer Größe von 12 bis 18 Metern aus.
Palaeoniscus Freieslebeni, zu Deutsch auch "Kupferschiefer-Hering" genannt, ist eine 259 bis 254 Millionen Jahre alte, ausgestorbene Art der Knochenfische. Das abgebildete Exemplar zeigt ein vollständiges Skelett und stammt aus Mansfeld.
Pfeilspitzen aus Silex, eine durchbohrte Steinaxt aus Mockritz, ein Webgewicht aus Prohlis und ein verziertes Miniaturgefäß bilden das typische Fundspektrum der menschlichen Besiedlungsgeschichte.
Susanne Koch
Quelle: Stadtarchiv Dresden, 17.2.100 Sammlung Ortsarchiv Leubnitz-Neuostra
Juli 2023

Dresdens Kolonialkriegerdenkmal – Koloniale Spuren im Stadtraum
Ein großformatiger Aufruf erreichte die Leserschaft des Dresdner Anzeigers vom 18. September 1910. Die „Errichtung eines Denkmals (…) für die gebliebenen China- und Afrikakrieger“ sollte durch Spenden unterstützt werden. Der zwei Jahre zuvor gegründete Königlich Sächsische Militärverein ehemaliger Uebersee-Truppen Dresden und Umgebung hatte das Projekt im Vorfeld bereits konzeptionell und politisch vorangetrieben. Neben künstlerischen Entwürfen und einem planenden Denkmalsausschuss war eine Liste namhafter Staatsbeamter und Militärs zu einem Ehrenausschuss zusammengestellt worden, die der Verein zusammen mit der Annonce publizierte.
Die Aufrufs-Rhetorik verdeutlicht das manipulative Potenzial von Sprache: Sie argumentierte für die Errichtung eines „würdigen Denkmals für die gebliebenen China- und Afrikakrieger, die aus Dresden und Umgebung stammen oder die bei Dresdner Truppenteilen gedient haben“. Trotz 40jähriger Friedenszeit sei der kriegerische Geist aus den Herzen der deutschen Jugend nicht geschwunden. Dies habe sich gezeigt „als es galt deutsches Ansehen in China und Südwestafrika zu schirmen“. Jungdeutschland sei bereit gewesen, freiwillig in freudiger Hingabe an das Vaterland dem Ruf ihres obersten Kriegsherrn zu folgen. Verschwiegen wurden freilich die schweren Kriegsverbrechen, welche deutsche Militäreinheiten an den aufständischen indigenen Bevölkerungsgruppen in China (sog. Boxeraufstand 1900-01) und in der Kolonie Deutsch-Südwestafrika (Völkermord an den Herero und Nama 1904-08) verübten, obwohl sie damals in der deutschen und internationalen Öffentlichkeit breit und kontrovers diskutiert wurden.
Die Stadt Dresden verhielt sich distanziert. Der Rat plädierte erfolglos für einen Gedenkstein in „möglichst einfache[r] Gestaltung“ und zog sich 1912 in Absprache mit anderen sächsischen Städten ganz aus dem Projekt zurück. Am 12. Oktober 1913 wurde das Denkmal im Beisein von Vertretern des Sächsischen Königshauses sowie hoher Militärs und Truppen aus Sachsen und Berlin medienwirksam geweiht. Der Dresdner Anzeiger berichtete ausführlich. Entstandene Filmaufnahmen gehören heute zu den frühesten bewegten Bildern Dresdens und wurden von Christian Borchert später fotokünstlerisch verarbeitet. Im unmittelbaren Vorfeld des ersten Weltkrieges fand sich in den Symbolisierungen des Denkmals, der Reden und militaristischen Aufzüge kaum mehr eine Spur von Besonnenheit. Im Mai 1923 erhielt der Sockel mit dem auf dem Erdball zum Flug ansetzenden deutschen Adler eine zusätzliche Platte mit den Namen weiterer, im Ersten Weltkrieg gefallener „Sächsischer Kolonialkrieger“.
Nach dem Ende eines erneuten Weltkrieges wurde das schließlich als kriegsverherrlichend eingestufte Denkmal 1947 abgebaut. Eine der Bronzeplatten mit den Namen in Afrika gefallener Soldaten überdauerte zum Zweck des Totengedenkens in der Garnisionskirche und zählt heute zu den kaum bekannten kolonialgeschichtlichen Spuren im Stadtraum, deren Erforschung erst beginnt.
Dr. Stefan Dornheim
Quelle: Stadtarchiv Dresden, Sign. 6.4.40.1 Stadtplanungsamt Bildstelle, Nr. V83.
Juni 2023
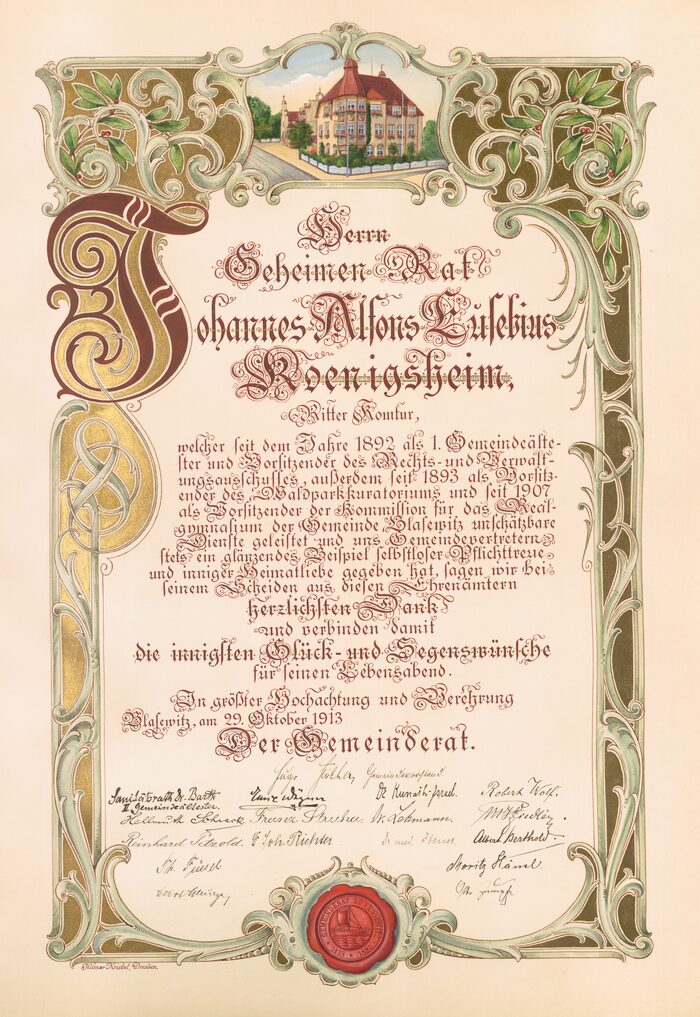
„…stets ein glänzendes Beispiel selbstloser Pflichttreue und inniger Heimatliebe…“. Der Teilnachlass der Familie Königsheim im Stadtarchiv Dresden
Mit dem Namen Königsheim verbindet Dresden die Erinnerung an den Begründer des Waldparks in Blasewitz, Arthur Willibald Königsheim (1816-1886). Er war Stammvater einer weitverzweigten Familie, deren Mitglieder dem Ort Blasewitz auch nach seinem Tod verbunden blieben. Im vergangenen Jahr übergab Werner Königsheim, ein Ururenkel Königsheims, den Familiennachlass an das Stadtarchiv Dresden.
Im Nachlass befinden sich zahlreiche private Dokumente verschiedener Generationen der Familie Königsheim – u. a. Taufurkunden, Collegienbücher, Bewerbungsschreiben, Bestallungsurkunden, Pensionsbescheide, private Fotos und Korrespondenz, Lebens- und Zeitzeugenberichte sowie eine Familienchronik.
Daraus kann das Leben vor allem der drei Söhne Arthur Willibald Königsheims rekonstruiert werden. Der älteste Sohn Emil Arthur Eduard (1846-1908) trat in das Militär ein und brachte es bis zum Königlich Sächsischen Oberst. Der mittlere Sohn Maximilian Willibald (1850-1892) wurde Kaufmann und betätigte sich geschäftlich in Amerika, London und Hamburg; er stiftete außerdem im Jahr 1886 die Familiengruft auf dem Johannisfriedhof. Der jüngste Sohn Johannes Alfons Eusebius (1854-1928) folgte seinem Vater in den Staatsdienst. Eine ihm zugewidmete Dankesurkunde des Gemeinderates Blasewitz aus dem Jahr 1913 wird im Juni 2023 als Archivalie des Monats im Lesesaal des Stadtarchivs präsentiert.
In einem Nachruf auf Johannes Alfons Eusebius ist nachzulesen, dass er in der Kindheit an gesundheitlichen Problemen litt und der Arzt dem Vater riet, aufs Land zu ziehen, was den Anstoß zur Übersiedlung der Familie nach Blasewitz gab und in Folge zur Begründung des Waldparks führte. Als sein Vater die Verhandlungen mit den Bauern führte, denen der Blasewitzer Tännicht und die benachbarten Felder und Wiesen gehörten, „wurde der Junge als Bote mit den Verträgen zu den Einzelnen geschickt. So war von klein auf sein Denken und Fühlen mit Blasewitz und dem Waldpark verankert.“
Nach Anstellungen in Schwarzenberg und Löbau wurde er 1891 an die Kreishauptmannschaft Dresden versetzt und wohnte in der väterlichen Villa in Blasewitz. Der Gemeinderat zu Blasewitz wählte ihn 1892 zum ersten Gemeindeältesten und Stellvertreter des Gemeindevorstandes. In dieser Funktion diente er dem Ort über 20 Jahre lang. Bei seinem Ausscheiden widmete ihm der Gemeinderat die vorgestellte, prächtig gestaltete Dankesurkunde.
Claudia Richert
Quelle: 16.2.129 Königsheim (Familiennachlass), Sign. 14
Mai 2023
Weiße Wäsche, weite Wiesen.
Es ist das Jahr 1900 und man stelle sich einen Spaziergang im Mai vor, der Himmel klar und ein angenehm belebender Duft weht von den nahen Elbwiesen herüber. Es ist der Geruch von Frische und Reinheit, von gewaschener, vor allem weißer Wäsche, die zum Bleichen bestimmt im Gras niederliegt. Eingedenk der eigenen, gewiss im Winter immerkalten, im Sommer drückend heißen, muffigen Dachkammer, ein Geschenk für die Seele. Was aber für die einen romantisch oder erquickend daherkommt, ist für andere schwerste Arbeit.
Das Bleichen von Wäsche wurde gewerblich sowohl von Großwäschereien als auch von vielen kleinen Wäscherei- und Färbereibetrieben, Lohnwäschereien und unzähligen Waschfrauen übernommen. Als Besonderheit sind hier unbedingt die Frauen außerhalb der steinernen Stadt, aus den rechtselbischen Dörfern im Dresdner Osten, von Loschwitz bis Pillnitz, zu nennen. An dortigen Bächen wuschen sie und bleichten am Bleichplan. Fertige Wäsche wurde dann von ihnen zur Kundschaft in die große Stadt gebracht, Schmutzwäsche auf dem Rückweg wieder mitgenommen. Das geschah zu Fuß mit dem Handwagen oder man nutzte das in den Sommermonaten verkehrende Wäscheschiff sowie den Wäschewagen der Straßenbahnlinie 11.
Beim Wäschewaschen unterschieden sich die Verfahren und Arbeitsweisen zwischen einer Großwäscherei und dem Waschen im kleingewerblichen, dörflichen Milieu stark, während beim Bleichen jedoch vieles ähnlich gemacht wurde. Die hier abgebildete Rasenbleiche, bei der die im Freien ausgelegten, beständig mit Wasser benetzten Wäschestücke in der Sonne trockneten und somit ein natürliches Bleichergebnis erzielt werden konnte, blieb lange Zeit die vorherrschende Methode, bevor diese gegen Ende des 19. Jahrhunderts allmählich von der Kunstbleiche in den größeren Betrieben abgelöst wurde. Neben dem technischen Fortschritt, mit neuen Waschverfahren und Maschinen, trugen die beiden Weltkriege wie auch die Bebauung des Königufers sowie mitunter ästhetische und sittliche Befindlichkeiten dazu bei, dass das Bild von ausgelegter weißer Wäsche vor der Stadtsilhouette immer seltener wurde, bis es schließlich verschwand.
Strahlend weiße Wäsche, das Ergebnis all der Mühen, gab es nur durch harte Arbeit. Erinnert sei an Verbrennungen und Verätzungen, an schwielige Hände und an die vielen krummen Rücken, daneben aber auch an allzu geschwätzige Frauen, wodurch die Bezeichnung „Waschweib“ zu einer spöttischen, abwertenden wurde.
Patrick Maslowski
Quelle: Stadtarchiv Dresden, 6.4.40 Stadtplanungsamt, Bildstelle, Schlüsselnr. VIII898
April 2023
Sport frei für Dresdens Sportlerinnen und Sportler. Die Vision eines Sportheims im Rudolf-Harbig-Stadion
Als Archivalie des Monats stellt das Stadtarchiv Dresden in diesem Monat eine Planungsskizze eines Sportheims auf dem Gelände des Rudolf-Harbig-Stadions aus. Die Bauzeichnung ist Teil des Aktenbestands, der sich mit dem Wiederaufbau der Sportstätte nach dem Zweiten Weltkrieg befasst. Das Stadiongelände inmitten Dresdens hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Im Zweiten Weltkrieg wurde die sogenannte Illgen-Kampfbahn schwer zerstört und der Platz wurde auch für die Ablagerung von Trümmern benutzt.
In der Verfassung der DDR war die Förderung der Körperkultur sowie des Schul- und Volkssports vorgeschrieben, so dass man, auch aufgrund mangelnder Sportanlagen in der Stadt, frühzeitig mit dem Aufbau des Stadiongeländes begann. Am 1. Juli 1951 sollte laut den Akten die Eröffnung des Rudolf-Harbig-Stadions stattfinden. Es fehlten jedoch Umkleidekabinen für die zu erwartenden Sportlerinnen und Sportler. Da zum Eröffnungstermin die Umkleiden nicht fertiggestellt werden konnten, ertüchtigte man als Notlösung eine alte Baracke. Die Einweihung fand dann am 23. September 1951 statt.
Um die Situation der Sportlerinnen und Sportler zukünftig zu verbessern, wurde der Bau eines Sportheims an der südwestlichen Ecke des Grundstücks, nahe der Bürgerwiese und inmitten der Parkanlagen geplant. Der Bau war notwendig geworden, da es keine ausreichenden Umkleide-, Wasch- und WC-Anlagen auf dem Gelände gab. Konzipiert wurden die Anlagen für circa 140 Personen. Zusätzlich sollten noch ein Trocken- und Massageraum eingerichtet werden. Zum Sportheimkomplex gehörten noch eine Kegelbahnanlage und eine darüber liegende Turnhalle. Aufgrund von finanziellen Engpässen wurde das Vorhaben nicht umgesetzt, auch weil die Idee aufkam, an selber Stelle ein Eislaufstadion zu errichten, das im Sommer als Rollschuhbahn genutzt werden konnte. Hierfür hatte die DDR-Regierung Fördermittel in Aussicht gestellt. Seit 1957 gibt die SG Dynamo Dresden, die am 12. April 2023 ihren 70. Geburtstag feiert, dem Gelände bis heute ein Gesicht.
Marco Iwanzeck
Quelle: Stadtarchiv Dresden, 10 Bauakten, Nr. 73148.
März 2023
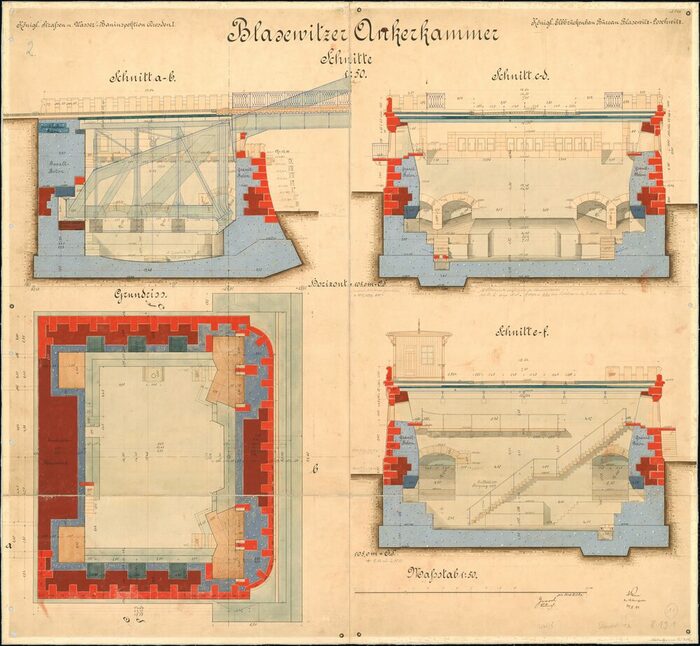
130 Jahre alt und noch immer ein „Blaues Wunder“. Die Geschichte einer lange geforderten Brückenverbindung zwischen Loschwitz und Blasewitz.
In diesem Jahr feiert ein Wahrzeichen der Stadt einen runden Geburtstag. Die Loschwitzer Brücke, wie sie eigentlich mit offiziellem Namen heißt, wurde am 15. Juli 1893 feierlich eröffnet und für den Verkehr freigegeben. Davor war eine Elbüberquerung viele Jahrhunderte lang nur per Fähre möglich. Mit Beginn des 19. Jahrhunderts wuchs das Verkehrsaufkommen stetig an, wodurch es oft zu Überlastungen kam. Besonders im Winter bei Schnee und Eis sowie bei Hochwasser war eine Überfahrt mit der Fähre keine verlässliche, sichere und angenehme Reisevariante. Am 15. Oktober 1883 lag die erste Petition des Loschwitzer Gemeinderats wegen einer Elbbrücke zwischen Blasewitz und Loschwitz vor, nachdem vorherige Bemühungen fehlgeschlagen waren. Von der Planung bis zum Bau vergingen jedoch fast zehn Jahre, da viele Spötter und Gegner sich dem Projekt in den Weg stellten.
Am 1. April 1891 erfolgte schließlich der erste Spatenstich. Nach zweijähriger Bauphase und einer Belastungsprobe, deren Bild fast allen Dresdnerinnen und Dresdnern bekannt sein dürfte, war das technische Wunderwerk des Bauingenieurs und Professors für Brückenbau Claus Köpcke Wirklichkeit geworden. Die Kosten der versteiften, drei-gelenkigen Hängebrücke aus Stahl beliefen sich dabei auf 2.265.572,55 Mark.
Unsere Archivalie des Monats März zeigt aquarellierte Konstruktionszeichnungen auf Karton, die diesen Monat im Lesesaal des Stadtarchivs Dresden, Elisabeth-Boer-Straße 1, mit einigen anderen Bildern zu sehen sind. Abgebildet sind Schnitte und der Grundriss der Blasewitzer Ankerkammer, die einen Blick in das Innere der sonst vermauerten Ankerkammern gewähren. Besonders interessant ist der Schnitt oben links, der die Stahlkonstruktion des Ankers zeigt. Unten rechts ist die Zeichnung eines kleinen Häuschens auf der Brücke zu sehen, eins der beiden Brückenzollhäuschen. Bis zur Eingemeindung von Loschwitz im Jahr 1921 mussten alle, die die Brücke passieren wollten, nach dem „Tarif für die Erhebung des Brückengeldes“ drei Pfennige zahlen. Für Kinder unter zwölf Jahren betrug die Gebühr 2 Pfennige.
Anfangs hieß das Bauwerk amtlich „König-Albert-Brücke“, doch diese Bezeichnung fand keinen Weg in den allgemeinen Sprachgebrauch der Anwohnerinnen und Anwohner. Bereits im Jahr der Fertigstellung nannte der Volksmund die Brücke aufgrund ihres blauen Farbanstrichs und der neuartigen Bauweise das „Blaue Wunder“.
Susanne Koch
Quelle: Stadtarchiv Dresden, 6.4.44 Straßen- und Tiefbauamt Brückenarchiv, Nr. M.1_17
Februar 2023
Kuriose Schaustellungen in Dresden. Von historischen Ballonfahrten, Seiltänzen und anderen Ergötzlichkeiten
Vor 175 Jahren verstarb Wilhelmine „Minna“ Reichard (1788 – 1848) in Döhlen, die als erste deutsche Ballon-fahrerin in die Geschichte einging. Nach zwei gelungenen Aufstiegen in Berlin startete die Braunschweigerin am 30. September 1811 auch in Dresden ihren Flug mithilfe eines „mit Wasserstoffgas gefüllten Luftballs“. Waghalsig unternahm damals die zweifache, und zu diesem Zeitpunkt schwangere Mutter trotz ungünstiger Wetterverhältnisse ihre berühmte Reise, bei der sie Schätzungen zufolge eine Höhe von bis zu 7800 Metern erreichte. Den folgenden spektakulären Absturz in der Sächsischen Schweiz überlebte Minna Reichard nur um Haaresbreite. Wie in anderen Städten bestand auch in Dresden ein reges Interesse an diesen frühen aeronautischen Unternehmungen. So soll etwa ein Drittel der Einwohnerschaft beim Aufstieg von „Madame Reichard“ in nächster Nähe dabei gewesen sein. Auch die Ballonfahrt im Mai des Vorjahres durch den Würzburger Mechanikus Sebastian Bittorf (1764 – 1812) war bestens besucht, weshalb er schon im Juli 1810 in Dresden eine weitere unternahm.
Die beiden Luftreisenden und andere Fremde in der Stadt, die derartige „öffentliche Lustbarkeiten“ veranstalten und damit Geld verdienen wollten, benötigten hierfür eine Genehmigung vom Landesherrn. Ihren Anträgen legten sie oft aussagekräftige Dokumente bei, wie etwa Empfehlungsschreiben, Flugblätter oder Anschlagzettel. Gegen Gebühr wurde dann eine zeitlich begrenzte Erlaubnis für die Darbietungen erteilt, wobei auch eine zusätzliche Abgabe für wohltätige Zwecke obligatorisch war. Die „fremden“ Gäste stammten im 18. und beginnenden 19. Jahrhundert insbesondere aus anderen deutschen Staaten sowie aus italienischen und französischen Städten. Besonders populär war die Zurschaustellung von physikalischen Experi-menten, mechanischen Apparaten, Wachsfigurenkabinetten, wilden oder dressierten Tieren, aber auch von Menschen. Häufiger fanden sich zudem akrobatische Vorführungen. Im Spätsommer 1811 präsentierte etwa der Seiltänzer Joseph Ambrosio aus Madrid im Jägerhof seltene Kunststücke. „Il Signor Ambrosio“ war nach eigenen Angaben schon in allen großen Städten Europas aufgetreten, darunter in Paris zur Kaiserkrönung Napoleons. Sein „großer Spiegelsprung“ mitten durch ein Feuerwerk aus drei „gegen einander schlagende Sonnen“ war eine weitere von vielen Ergötzlichkeiten aus dem Ausland, die den städtischen Alltag in der napoleonischen Zeit bereicherten.
Johannes Wendt
Quelle: Stadtarchiv Dresden, 2.1.3, Ratsarchiv, C.XVII.67, II, retuschiert.
Januar 2023
Für Näh- und Schreibmaschinen ist „Der Wille des Werkes Seele“. Die Aktiengesellschaft „Seidel & Naumann“ in Dresden
Am Sonntag, 22. Januar 2023, jährt sich der Todestag von Bruno Naumann, dem Begründer des Unternehmens „Seidel & Naumann“, zum 120. Mal. Nach Beendigung seiner Lehrzeit bei dem Dresdner Mechaniker und Direktor des Eichamtes Hugo Schuckert, begann Naumann im Jahr 1868 sein selbstständiges Wirken in einer kleinen Werkstatt für Feinmechanik in der Neuen Gasse in der Nähe des Pirnaischen Platzes. Die Produktion von Nähmaschinen wurde zu seinem Geschäftsfeld. Im Jahr 1870 gewann er Emil Seidel als Teilhaber und gemeinsam begründeten sie die Handelsgesellschaft „Seidel & Naumann“. Naumann hatte mit der Nähmaschine auf ein Produkt gesetzt, das zum Ende des 19. Jahrhunderts seinen Siegeszug in den privaten Haushalten fortsetzte.
Alsbald wurden die Betriebsräume zu klein und 1883 erwarb Naumann ein größeres Gelände an der Hamburger Straße, zu diesem Zeitpunkt noch weit außerhalb Dresdens gelegen. Bisher waren nur Nähmaschinen hergestellt worden, aber Naumann folgte dem Zeitgeist aufmerksam und sah im Fahrrad ein Verkehrsmittel der Zukunft. Ende 1887 konnte das Unternehmen „Seidel & Naumann“, nunmehr als Aktiengesellschaft, die ersten Fahrräder der Marke „Germania“ ausliefern. Gerade die Herstellung von Fahrrädern sorgte für wachsenden Umsatz und machte eine Erweiterung des Standorts an der Hamburger Straße notwendig. Zur Jahrhundertwende wurden jährlich etwa 80.000 Nähmaschinen und 30.000 Fahrräder erzeugt.
Neben der Produktion von Nähmaschinen, Fahrrädern und Geschwindigkeitsmessern begann das Unternehmen im Jahr 1899 mit dem Bau der „Ideal-Schreibmaschine“. 1918 erstreckte sich die Werksanlage über 50.000 Quadratmeter und etwa 4.300 Menschen arbeiteten in diesem Fabrikkomplex. Bereits von 1885 bis 1888 hatte Karl August Lingner als Korrespondent der Firma Geschäftsbriefe in deutscher und französischer Sprache verfasst und für die Produkte geworben. Den Erfolg der Schreibmaschine „Erika“, die ab 1910 gebaut wurde, erlebte Bruno Naumann nicht mehr, da er 1903 nach kurzer Krankheit starb. Die letzte Kleinschreibmaschine vom Typ „Erika“ lief im August 1991 vom Band. Insgesamt 8,5 Millionen Exemplare wurden innerhalb dieses Zeitraums verkauft.
Marco Iwanzeck
Quelle: Stadtarchiv Dresden, 18 Bibliothek, Hist. Dresd. 55.51a.
Archivalien des Monats aus dem Jahr 2022
Dezember 2022
Eine Kostbarkeit zum Sinnieren. Das Stammbuch von Paul Buchner dem Jüngeren (1574 – 1626)
Der Jahresausklang steht vor der Tür. Eine gute Gelegenheit, einmal wieder die Gedanken schweifen zu lassen und in Erinnerungen zu schwelgen. „Allzeit fleißig [sein], ist unmöglich“, schrieb schon der Baumeister Moritz Wienner im Jahr 1600 in das Stammbuch von Paul Buchner dem Jüngeren und illustrierte den Sinnspruch mit einer grotesken Zeichnung von zwei auf Schnecke und Krebstier reitenden Kombattanten. Der Halter des Stammbuches war der Sohn des Oberzeugmeisters Paul Buchner des Älteren (1531 – 1607), der zu Lebzeiten als einer der angesehensten Waffentechniker und Festungsbauer im deutschsprachigen Raum galt. Er realisierte aber auch andere bedeutende Bauten für die sächsischen Kurfürsten, wie den heute insbesondere in der Weihnachtszeit allseits beliebten Stallhof. Paul Buchner der Jüngere trat 1606 als Oberzeugmeister in die Fußstapfen seines Vaters.
Stammbücher entstanden in der Zeit der Reformation und dienten zunächst der Sammlung von Autografen. Insbesondere in studentischen Kreisen entwickelte sich das Stammbuch dann zu einem Medium der Freundschaft weiter. Durch persönliche Widmungen, filigran gezeichnete Wappen oder individuelle Illustrationen wurden Freundschaften und Erinnerungen an vergangene Zeiten gefestigt. Heute stellen Stammbücher wertvolle historische Quellen dar, auch weil die handschriftlichen Eintragungen für private Zwecke bestimmt waren und nicht der Zensur unterlagen.
Buchners Stammbuch enthält mehr als 50 Wappen und Zeichnungen, die überwiegend koloriert wurden. Dabei fällt zunächst die Dominanz von Widmungen zu religiösen, konfessionellen und kriegerischen Auseinandersetzungen unmittelbar ins Auge, die vor dem Hintergrund des sogenannten Langen Türkenkrieges (1593 – 1606) zu interpretieren sind. Zahlreiche Einträge thematisieren auch Lebensführungspraktiken und laden zum Sinnieren ein. So untertitelte etwa Hans Barà 1603 seine Zeichnung von einem Festgelage in Buchners Stammbuch sinngemäß mit den Worten: „Wer einen Apfel schält, und ihn nicht isst, eine Jungfrau herzt, und sie nicht küsst, hat kühlen Wein, und schenkt nicht ein, der soll ein Mönch in einem Kloster sein.“
Johannes Wendt
Quelle: Stadtarchiv Dresden, 17.5, Handschriftensammlung, Hs.1937.1952, Bl. 60r, retuschiert
November 2022
Alle Jahre wieder gibt es Stollen auch in Übersee. Alwin Mucke – Welt-Versandhaus Dresdner Christstollen
Am 23. November 2022 soll nach zwei Jahren Pause der Striezelmarkt eröffnen und auch das allseits beliebte Stollenfest stattfinden. In Dresden war die traditionell handwerkliche Herstellung von Christstollen schon seit der Frühen Neuzeit Brauch. In den Ratsakten taucht das Backwerk in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts unter den Bezeichnungen „Christbrot“, „Striezel“ und „Stollen“ auf. Die Europäische Union hat im Jahr 2010 den Stollen unter geschützte geografische Angabe gestellt und somit Dresden als Herkunftsgebiet dieses Gebäcks ausgewiesen. Die ehemalige Vielfalt und Varianz von Zutaten wurde für die EU-zertifizierte Fassung des Dresdner Christstollens festgeschrieben. So müssen Rosinen, Butter, süße und bittere Mandeln, Orangeat, Zitronat, Mehl, Wasser und Hefe traditionell Bestandteile des Teiges sein.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es eine solche Schutzmarke noch nicht, so dass die Dresdner Bäckereien auch außergewöhnliche Stollen für die unterschiedlichsten Geschmäcker anboten. Besonders stach das „Welt-Versandhaus Dresdner Christstollen“ von der Feinbäckerei Alwin Mucke hervor, die den Stollen in alle Erdteile exportierte. Laut Mucke existiere „kein bedeutender überseeischer Ort, wo nicht Deutsche alljährlich Muckes Christstollen zum Weihnachtsfest geniessen.“ Muckes Weihnachtsgebäck gab es in unterschiedlichen Zubereitungsweisen. Die Rosinen- und Mandelstollen wurden in zwei Qualitätsstufen gebacken. Das höchste kulinarische Niveau erreichten die Rosinen- und Mandelstollen der „Marke Königin Carola mit extrafeiner schwerer Qualität.“ Die günstigere Variante war „weniger schwer, aber trotzdem reich mit Rosinen und Zitronat versehen.“ Im weiteren Angebot befanden sich Nuss- und Mohnstollen, Muckes bürgerlicher Hausbäckerstollen und als preiswertige Variante Muckes Steuer Stollen. Hinter dem Aleuronat-Stollen versteckte sich das Festgebäck für Zuckerkranke, während die Menschen mit Magenproblemen eher auf den Schrot-Stollen zurückgreifen sollten. So war für Jeden etwas dabei und niemand brauchte auf das Festgebäck verzichten.
Marco Iwanzeck
Quelle: Stadtarchiv Dresden, 17.4.1 Drucksammlung, Nr. 278 II
Oktober 2022
Eine runde Sache. Das Filmtheater Prager Straße wird 50.
Kaum zu glauben, so frisch und modern das Gebäude erscheint, das Filmtheater Prager Straße, kurz Rundkino genannt, feiert in diesen Tagen Jubiläum. Baustart war im Oktober 1969, offiziell eingeweiht wurde der Bau drei Jahre später, am 7. Oktober 1972, dem Tag der Republik. Die Planungen für das Kino begannen bereits Anfang der 1960er Jahre, eingebettet in das große Vorhaben des Aufbaus der Prager Straße als neues Zentrum für Einkauf und Tourismus. Demnach sollte schließlich das Filmtheater als vorläufiger Abschluss an der Nordseite der Flaniermeile entstehen, und das – sich bewusst von den umliegenden quaderförmigen Gebäuden unterscheidend – in zylindrischer Bauweise. Der Entwurf hierfür stammte von Manfred Fasold und Winfried Sziegoleit, umgesetzt wurde er von Waltraud Heischkel und Gerhard Landgraf. Die weithin sichtbare, freistehende Rotunde mit ihrer feinen Fassade bildete besonders nachts, wenn angestrahlt, in der Gesamtheit mit den umgebenden Wasserspielen ein Highlight, eingedenk der Tatsache des jahrelang brachliegenden Areals.
Überhaupt war es der erste Kinoneubau in Dresden nach den Zerstörungen des 2. Weltkrieges, und aufgrund seiner Ausstattung diente es fortan als Erstaufführungshaus im Bezirk. Seine Leinwand war mit beinahe zwanzig Metern Breite und zehn Metern Höhe enorm, die 70mm-Abspieltechnik das damals Modernste. Obwohl als erstes die Teile vier und fünf des sowjetischen Filmepos „Befreiung“ liefen, kam insgesamt ein gemischtes Programm zur Vorführung: neben ‚politisch und künstlerisch wertvollen Filmen‘ waren es auch Unterhaltungsfilme. Dabei spielten sich im großen Saal mit 1.036 Plätzen die meisten Aktivitäten ab. Filmkunst gab es in der kleinen Bühne, dem sogenannten Studiokino, mit 132 Plätzen, gleichzeitig Heimstätte mehrerer Filmklubs. Ein Zweisaalkino existierte bis dahin noch nicht.
Seit den 1990er Jahren erlebte das Rundkino eine recht wechselvolle Geschichte mit verschiedenen Eigentümern, zwischenzeitlichem Aufführungsverbot, Umbauten, auch der Zuerkennung des Denkmalschutzstatus und der Etablierung als 3D-Kino. Mittlerweile, weil umbaut, kaum noch als Rundkino erkennbar, versprüht selbiges ein halbes Jahrhundert nach seiner Errichtung immer noch architektonische wie cineastische Strahlkraft.
Patrick Maslowski
Quelle: Stadtarchiv Dresden, 17.6.1 Ansichtskarten, Nr. SS 24
September 2022
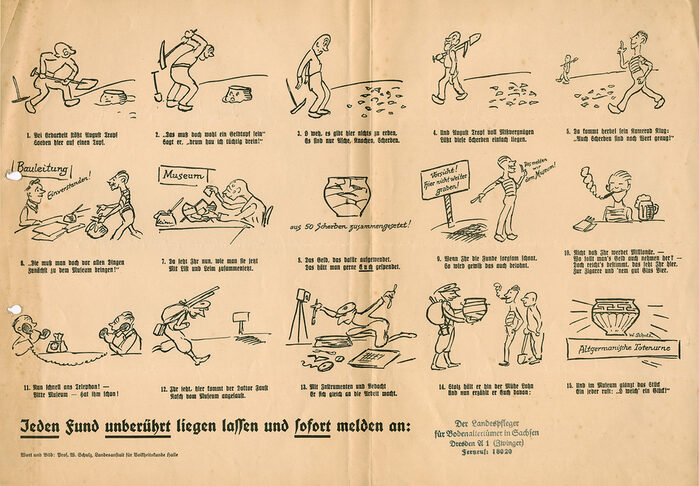
Das Stadtarchiv im Boden. Versteckt – entdeckt – Großprojekt?
Über Jahrhunderte, sogar über Jahrtausende überdauern archäologische Strukturen und Funde unberührt im Boden. Dort sind sie am besten vor Zerstörung geschützt. Der Boden übernimmt somit die Aufgabe eines Archives – er bewahrt kulturelle Hinterlassenschaften. Doch immer wieder droht durch Baumaßnahmen, Erosion oder illegale Sondengänger dieser sichere Ort gestört zu werden. Wie unsere Archivalie des Monats September zeigt, erkannte man bereits in der Archäologie der 1920er und 1930er Jahre, wie wichtig es ist, dem Laien den richtigen Umgang mit Bodenschätzen näher zu bringen.
Professor W. Schulz von der damaligen Landesanstalt für Volkheitskunde Halle illustrierte dafür dieses undatierte Merkblatt für den „Landespfleger für Bodenaltertümer in Sachsen“. Zu sehen ist zunächst ein Erdarbeiter, der einen vergrabenen Topf freilegt. In der Hoffnung einen Schatz gefunden zu haben, zerstört er ihn umgehend. Die Enttäuschung ist groß, als er darin kein Gold findet, und er lässt die Scherben unbeachtet liegen. Sein Kollege erkennt jedoch den Wert des Fundes und übergibt ihn dem Museum. Im Anschluss zeigt dieser Kollege, wie man im Falle eines Bodenfundes richtig vorzugehen hat. Die Stelle bleibt unberührt, wird gesichert und die zuständige Behörde informiert.
Im Grunde gilt das heute noch immer. Bei der Entdeckung eines im Boden liegenden Objekts sowie der Freilegung von Verfärbungen oder Strukturen ist unverzüglich das Landesamt für Archäologie zu verständigen. Wichtig ist, alles unverändert zu lassen. Denn für die Archäologen ist nicht nur ein einzelnes Fundobjekt von Interesse, sondern der gesamte Befund. Darunter versteht man im Boden erkennbare Einzelstrukturen wie Gruben, Mauern, Gräben oder Erdschichten. Bei der fachlichen und systematischen Ausgrabung und Dokumentation können die Experten Aussagen über Funktion und Datierung der Funde und Befunde treffen.
Sehr häufig kursiert das Vorurteil, dass Archäologen Baustopps und unnütze Kosten verursachen und alles in ein Großprojekt mündet. Tatsächlich liegt dem Landesamt für Archäologie sehr daran, die Bodenschätze so gut wie möglich durch Abdeckung oder Einbindung in den Neubau in der Erde zu bewahren und nur die von Tiefbaumaßnahmen betroffenen Flächen auszugraben. Denn jede Ausgrabung bedeutet die unwiederbringliche Zerstörung von Bodendenkmälern. Und wo ist Kulturgut besser aufgehoben als im (Boden)Archiv?
Susanne Koch
Quelle: Stadtarchiv Dresden, 17.2.100 Sammlung Ortsarchiv Leubnitz-Neuostra, Nr. 70
August 2022
Weihnachtsdeko im Hochsommer. Erinnerungen an die „Jahrhundertflut 2002“
Im August letzten Jahres veröffentlichte das Stadtarchiv Dresden unter dem Slogan „Jahrhundertflut 2002 – Erinnerungen gesucht“ einen Aufruf, um Material für die Ausstellung zur Jahrhundertflut zu sammeln. Die Bürger*innen wurden gebeten, ihre Erinnerungen an diese Zeit mit uns zu teilen und Bildmaterial, Geschichten und Erinnerungsstücke für die Ausstellung zur Verfügung zu stellen. Unter den 78 Abgaben waren zahlreiche Fotos, Publikationen und private Aufzeichnungen, die einen imposanten Eindruck jener Tage vermittelten.
Darüber hinaus erhielt das Stadtarchiv einige sehr persönliche Objekte, die mit emotionalen, zum Teil skurrilen bis hin zu witzigen Anekdoten verbunden sind. Ein Beispiel für eine sehr berührende Geschichte bilden zwei Nussknacker, die wir für die Ausstellung als private Leihgabe erhalten haben. Die bemalten Holzfiguren fristeten ihr Dasein – schließlich war Hochsommer – zusammen mit anderer Weihnachtsdekoration in einem Keller auf der St. Petersburger Straße im Zentrum von Dresden. Nachdem die Weißeritz nach tagelangen Starkniederschlägen am 13. August 2002 die Innenstadt erreicht hatte, kam es durch eindringendes Schmutzwasser zur Überflutung des Kellers. Die persönlichen Dinge konnten nur nass und beschädigt gesichert werden. Doch insbesondere die beiden Nussknacker lagen ihrer Besitzerin am Herzen. Die emotionale Verbundenheit reicht bis weit in die Kinder- und Jugendzeit zurück. Einen der Nussknacker kaufte die Dresdner Köchin 1965 zu Beginn ihrer Ausbildung in einem Laden auf der Hauptstraße von ihrem ersten Lehrlingsgehalt. Der zweite Nussknacker war ein Geschenk ihrer Mutter, sozusagen ein Familienerbstück. Die beiden Weihnachtsfiguren waren über Jahrzehnte ein fester Bestandteil familiärer Tradition und Inbegriff schöner Erinnerungen, so dass sich die Besitzerin kurzerhand dazu entschloss, die Nussknacker restaurieren zu lassen. Auf diese Weise wurden beide nicht nur vor dem Sperrmüll gerettet, der in großen Massen nach den Tagen der Flut entsorgt wurde, sondern sie erhielten zugleich eine bewegte Geschichte, die gemeinsam mit den Nussknackern von Generation zu Generation weitergegeben werden kann.
Das Stadtarchiv Dresden dankt allen Abgebenden für ihre Unterstützung der Ausstellung „NEUN METER VIERZIG – Die Jahrhundertflut in Dresden 2002“, zu der wir Sie alle herzlich einladen. Die Eröffnung findet am 17. August 2022 um 19 Uhr statt. Die Ausstellung kann bis zum 4. November 2022 kostenfrei besucht werden.
Sylvia Drebinger-Pieper
Quelle: Stadtarchiv Dresden, Ausstellung „NEUN METER VIERZIG“, Fotografin: Renate Fehrenbach
Juli 2022
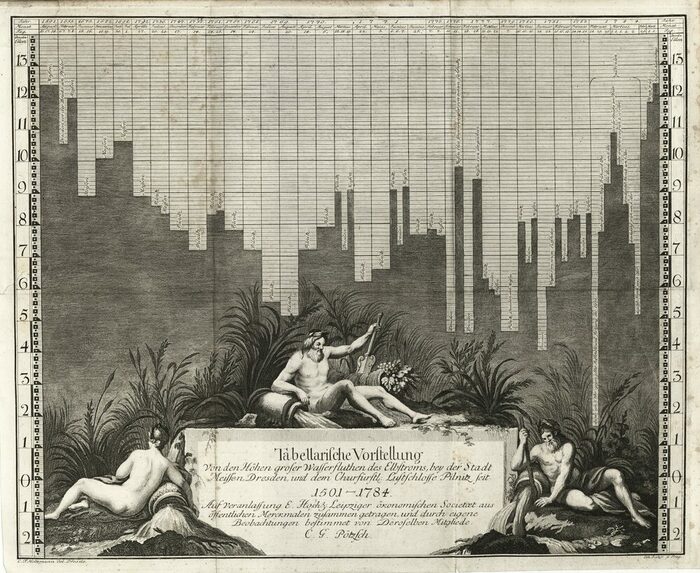
Christian Gottlieb Pötzschs „Chronologische Geschichte der großen Wasserfluthen…“
Bis heute ist das Grundwissen über die historischen Hochwasser unserer Stadt mit dem Namen Christian Gottlieb Pötzsch (1732 - 1805) und dessen Standardwerk „Chronologische Geschichte der großen Wasserfluthen des Elbstroms seit tausend und mehr Jahren“, erschienen 1784 in Dresden, verbunden. Pötzsch stammte ursprünglich aus Schneeberg und galt trotz fehlender Schulbildung als ein autodidaktisches Genie. Neben dem Studium der Mineralogie, das ihm eine Stellung als Aufseher der kurfürstlichen Naturalien-Sammlung in Dresden einbrachte, dokumentierte er intensiv seine Wetterbeobachtungen und die Veränderungen der Pegelstände der Elbe. Um seine Überlegungen zur Hochwasserentwicklung nachweisen und auswerten zu können, richtete Pötzsch die ersten festen sächsischen Pegel an der Elbe ein – in Meißen 1775 und im Folgejahr in Dresden. Seine Abhandlung umfasst 232 Seiten und stellt eine chronologische Aufzeichnung von 188 Elbfluten dar. Dabei stützte sich der Autor auf die Auswertung von Chroniken, Hochwassermarken, Schadensberichten und Pegelmessungen. Während erste vereinzelte Hinweise bis in die Zeit der sogenannten Elbgermanen zurückgehen, reicht die Aufstellung bis zum Frühjahrshochwasser im Jahr 1784. Die ab 1500 vorliegenden Hochwasserstände ermöglichten die graphische Darstellung in einer „Tabellarischen Vorstellung“ für Dresden, Meißen und Pillnitz, unsere Archivalie des Monats Juli.
Aus Pötzschs Übersicht geht hervor, dass die schwersten Hochwasser in den Jahren 1501, 1655 und 1784 auftraten. Während sich die Fluten von 1655 und 1784 im Februar sowie Anfang März ereigneten und mit Schneeschmelze und Eisstau zusammenhingen, war das Hochwasser von 1501 ein Ereignis im August infolge starker Regenfälle. Das Hochwasser ereignete sich fast auf den Tag genau 501 Jahre vor der Jahrhundertflut 2002. In den historischen Aufzeichnungen ist belegt, dass es ab dem 6. August 1501 für eine Woche zu außergewöhnlich starken Regenfällen in Böhmen kam. Zwischen dem 16. und dem 18. August 1501 erreichte die Elbe in Meißen eine Höhe von 12 Ellen und 10 Zoll über der normalen Wasserfläche. Eine Dresdner Elle entsprach damals 56,6 Zentimetern. Nach heutigem Maß lag dieses Hochwasser etwa 7 m über dem normalen Elbstrom, somit 2, 40 Meter unter dem Hochwasser von 2002.
Das Ausmaß der Zerstörungen war für die Zeitgenossen aber keineswegs weniger dramatisch als 2002 und stellte, wie in Pötzschs Quelle nachzulesen ist, einen gravierenden Einschnitt in das kollektive Gedächtnis der Stadt dar: „Allhier in Dresden füllte sie die Stadtgräben aus, daß sie überliefen. Auf der Brücke erlangte man das Wasser mit der Hand. Es machte solches aller Orten greulichen Schaden, führte ganze Scheunen mit Getraide und Heu, Häuser mit sammt den Giebeln, Mühlen, hölzerne Kirchen mit Thürmen sammt den Glocken fort.“
Sylvia Drebinger-Pieper
Quelle: Stadtarchiv Dresden, 18 Bibliothek, H.Sax.45.5540.
Juni 2022
Hans Erlwein – Zur Erinnerung an den 150. Geburtstag des berühmten Dresdner Stadtbaurat
Unter der Leitung von Hans Erlwein (1872-1914) entstanden in Dresden etwa 150 Gebäude, die teils von historistischen Stilen, teils vom Reform- oder Heimatschutzstil geprägt sind. Zweckmäßigkeit, Klarheit, Schlichtheit sowie die Gliederung des Aufbaus und die Einordnung in die örtliche Bautradition standen im gestalterischen Vordergrund. Die zahlreichen Bauwerke sind bis heute fester Bestandteil Dresdner Stadtbildtradition, deren Überdauern mittels aufwendiger Sanierungsarbeiten gesichert wird.
Während die Spuren Erlweins durch monumentale Gebäude wie den Erlweinspeicher, das Gaswerk Reick, den Vieh- und Schlachthof Dresden oder das Italienische Dörfchen allgegenwärtig sind, erinnern nur wenige Werke, beispielsweise die ehemalige Bedürfnisanstalt Pfotenhauerstraße oder die Turnhalle Bünaustraße, an den pluralistischen Werke-Kanon des Baurates. Besonders interessant ist daher die Suche nach den kleinen, praktischen oder dekorativen Bauten, deren materieller und nomineller Wert keine vergleichbare Zuwendung in der Erhaltung wie die Funktions- und Wohngebäude erfahren haben und die heute kaum mehr existent sind. Völlig verschwunden sind auch die aufwendigen Straßendekorationen, die in den vergangenen Jahrhunderten üblich waren und die der städtischen Bevölkerung „Hohen Besuch“ oder besondere Festtage ankündigten. Wirken diese Scheinbauten aus heutiger Sicht befremdlich und wenig nachhaltig, so geht aus den Akten der Stadt hervor, dass innerhalb der Jahre 1905 bis 1912 sieben dieser fulminanten Ausschmückungen zur Umsetzung kamen.
Die erste Erlweinsche Straßendekoration entstand 1899 in Bamberg zur Einweihung des Denkmals für den Prinzregenten Luipold. Nachdem Erlwein am 17. November 1904 als Stadtbaurat nach Dresden wechselte und im Februar 1905 auch die Leitung des Hochbauamtes übernahm, gehörte die Errichtung der Straßendekoration anlässlich des Kaiser-Besuchs Wilhelms II. (1859-1941) am 25. Oktober 1905 in Dresden zu seinen Aufgaben. Die Ehrenpforte mit dem Schriftzug „Dem Kaiser Heil“ befand sich auf der Prager Straße und markierte den Festzug bis zur Augustusbrücke. Die Kosten beliefen sich auf 25.918 Mark, während der Bau eines Toilettenhäuschens mit 3.400 Mark vergleichsweise günstig zu Buche schlug. Die antikisierende Ehrenpforte erinnerte in ihrer Gestaltung an einen Triumphbogen. Die zum Bau genutzten Materialien waren hingegen vergänglich und wurden meist direkt nach den Feierlichkeiten abgebaut. Dass die Ehrenpforten, die ihren Höhepunkt im 16. und 17. Jahrhundert erlebten und bereits seit der Aufklärung überwiegend als unnütze Verschwendung betrachtet wurden, ihren Reiz bis ins 20. Jahrhundert erhielten, zeigt die Archivalie des Mo-nats Juni im Stadtarchiv Dresden.
Sylvia Drebinger-Pieper
Quelle: Stadtarchiv Dresden, 6.4.40.1 Stadtplanungsamt Bildstelle, Nr. I622, unbekannter Fotograf, 1905
Mai 2022

Helga Knobloch – eine Dresdner Malerin und Grafikerin
Spielende Kinder, aber auch Hausarbeit verrichtende, Kinder, die Blumen pflücken, Sandburgen bauen, Schiffe bestaunen, sich um Haustiere kümmern, Kinder, die auf Post warten, gerade bekommen oder bereits lesen. Dergestalt entwarf Helga Knobloch ihre Szenerien und Figuren für Briefpapier, Umschläge und Briefmarken, liebevoll arrangiert als Konvolut, genannt Kinderpost. Es waren Motive mit und für Kinder, Heiterkeit und Freude ausstrahlend, die zum Briefeschreiben ermunterten.
Helga Knobloch blieb ihr Leben lang Dresden verbunden. Am 5. März 1924 in Loschwitz geboren, absolvierte sie eine Lehre als graphische Zeichnerin. Ihr im Februar 1945 zerstörtes elterliches Wohnhaus und die anschließenden Kriegswirren ließen sie kurzzeitig nach Luxemburg und Düsseldorf ziehen, bevor sie im September 1946 nach Dresden zurückkehrte und sich gleich im ersten Nachkriegsjahrgang an der Hochschule für Bildende Künste einschrieb. Sie studierte zunächst Malerei, dann Gebrauchsgrafik und lernte bei damaligen Größen wie Carl Rade, Joseph Hegenbarth, Hajo Rose und Hans Christoph. Mit Letzterem verband sie seitdem eine langjährige Lebens- wie Arbeitspartnerschaft. Dass sie eine großartige Künstlerin war, beweisen bereits ihre 1947/48 im Neustädter Bahnhof entstandenen Milieustudien, die sogenannten Bahnhofsbilder.
Nach Abschluss ihres mit Auszeichnung bestandenen Studiums 1952 arbeitete sie ihr gesamtes Berufsleben lang als Werbegrafikerin. Sie illustrierte Kinderbücher, entwarf Modegrafiken und gestaltete Plakate und Stände für die Leipziger Messe. Die oben thematisierte Kinderpost-Serie entstand in dieser Zeit. Erst in den späten 1980er Jahren wandte sie sich zunehmend wieder der Malerei zu, wovon einige Ausstellungen vor allem in den 2000ern zeugen. Helga Knobloch verstarb vor knapp zwei Jahren am 21. Juli 2020 in Dresden.
Abschließend bliebe, in Anlehnung an Helga Knoblochs bezaubernder Kinderpost, die Anregung, selbst mal wieder einen Brief zu schreiben, gerade an Menschen, die man gern hat … weil es sich lohnt.
Patrick Maslowski
Quelle: Stadtarchiv Dresden, 16.2.116 Helga Knobloch, Nr. 12.
April 2022
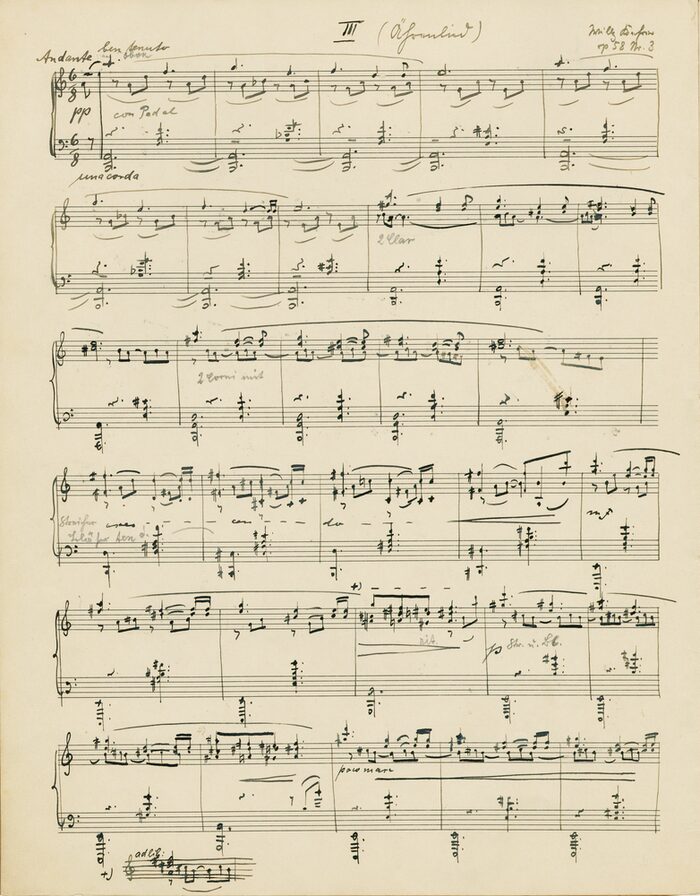
Als Begleitmusik zu Tänzen zu spielen. Der Nachlass des Komponisten Willy Kehrer im Stadtarchiv Dresden
Am 26. April jährt sich zum 120. Mal der Geburtstag des Dresdner Komponisten Willy Kehrer (1902 – 1976), dessen umfangreichen Nachlass das Stadtarchiv Dresden vor Kurzem übernahm. Eine Archivalie aus dem Nachlass wird diesen Monat im Lesesaal des Stadtarchivs Dresden, Elisabeth-Boer-Straße 1, präsentiert.
Willy Kehrer wurde in Dresden geboren und studierte an der Dresdner Musikhochschule Komposition, Klavier und Dirigieren. Er war als Liedbegleiter und Solist tätig, spielte zu Kabarettveranstaltungen im Café Altmarkt und komponierte nebenbei. An der Schule der Tanzpädagogin Lotte Dornig (1898 – 1985) begleitete er die Laienkurse. Daraus erwuchs eine lebenslange Freundschaft, von der auch Briefe im Nachlass zeugen. Die vorliegende Archivalie ist Lotte Dornig zugeeignet. Es handelt sich um ein gebundenes Notenheft mit zwölf Seiten. Das Werk trägt den Titel „Fünf Improvisationen für Klavier (Ernste Tänze) op. 58“ und ist mit der ausdrücklichen Bestimmung versehen, dass die Stücke „[n]ur als Begleitmusik zu Tänzen zu spielen“ seien.
Ab 1935 entwickelte sich eine bemerkenswerte, langjährige Zusammenarbeit mit Gret Palucca (1902 – 1993), die seine herausragenden Fähigkeiten als Improvisator schätzte. Bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1967 wirkte Willy Kehrer an der Paluccaschule als Pianist, Improvisator und künstlerischer Mitarbeiter. Er arbeitete mit Palucca im Unterricht zusammen, komponierte zahlreiche tänzerische Improvisationen und Etüden zu den Stoffgebieten des Neuen Künstlerischen Tanzes, schrieb Ballette und Tanzspiele für die Paluccaschule. Gret Palucca wiederum schuf zu seiner Musik mehrere Choreographien.
Willy Kehrers kompositorisches Werk erstreckte sich über nahezu alle Genres – Sinfonien, Ouvertüren, Orchesterstücke, Konzerte für Klavier, Violine, Horn, Kammermusik, Oratorien, Kantaten und Liederzyklen sowie mehrere Bühnenwerke. Außerdem schrieb er eine Abhandlung über Klavierimprovisation, in die seine jahrzehntelange Erfahrung als Pianist und Klavierimprovisator sowie als Pädagoge einfloss.
Sein Nachlass umfasst etwa 29 laufende Meter Archivgut. Darunter befinden sich nicht nur die Originalnoten seiner Kompositionen, sondern auch Tonbandaufnahmen, Tagebücher, Reisenotizen, private Dokumente und Fotos sowie Zeichnungen und Skizzen. Das Willy-Kehrer-Archiv wurde zunächst durch seine Ehefrau Alice Kehrer betreut, später durch die nachfolgende Familiengeneration. Nun befindet sich der Nachlass im Stadtarchiv Dresden, das eine fachgerechte Aufbewahrung und Benutzung gewährleisten wird.
Claudia Richert
Quelle: Stadtarchiv Dresden, 16.1.27 Nachlass Willy Kehrer, Karton O-44
März 2022
Verschollen! Das Schicksal der Dresdner Urkunden.
Der 13. Februar erinnerte gerade deutlich an die Zerstörung Dresdens und den Tod Tausender. Im Februar 1945 waren auch große Teile des Dresdner Stadtarchivs von Totalverlust bedroht. Genau in dieser Zeit übernahm eine der ersten deutschen Archivarinnen – Dr. Elisabeth Boer (1896/1991) - die stellvertretende Leitung des Stadtarchivs, unmittelbar nach dem Tod von Müller-Benedickt, dem langjährigen Direktor. Durch ihren Einsatz zum Schutz der wertvollen Bestände konnten mehr als dreiviertel des Bestandes gerettet werden. Auf ihre Initiative hin und die von Heinrich Butte, wurden schon 1943 wertvolle Bestände in die Oberlausitz verbracht, mit dem Näherrücken der Front jedoch 1944/45 zurückgeholt und teilweise in die Tiefkeller des Rathauses eingelagert. In blauen Pappbehältern und Urkundenschränken überstanden so große Teile der Bestände nahezu schadlos die Angriffe.
Jeglicher Zugang zu den Magazinen war auch nach dem Einmarsch der Truppen der Roten Armee für das Archivpersonal gesperrt, obwohl Elisabeth Boer deutlich auf die weiteren Schäden durch Wassereinbrüche verwies. Erst Mitte Februar 1946 wurde der Zutritt offiziell erlaubt. Einen Monat vorher schon, hatten leitende Mitarbeiter und am 18. Januar 1946 Elisabeth Boer die Räume illegal betreten und …konstatierten: „Im Ganzen ergab die Besichtigung ein immerhin tröstlicheres Bild, als vorher zu befürchten gewesen war ...der überwiegend wichtige Teil des Archivs ist uns erhalten geblieben.“ Als der Zutritt dann offiziell am 17. Februar 1946 gestattet wurde, fehlten 418 Pergamenturkunden aus den Jahren ab 1260 und annähernd 3000 Papierurkunden von 1476 an. Mitsamt diverser Schaustücke waren diese von russischen Offizieren abgeholt worden. Alle Mahnungen und Bemühungen seitens der Direktorin (1951 – 56) u. a. wurden unterbunden - sie selbst mundtot gemacht, daraufhin verließ sie das Stadtarchiv für immer. Im Juli 1958 wurden 211 Urkunden zurückgegeben, 1979 und vier Jahre später gab es kleinere Rückgaben. Erst im Dezember 1983 tauchten einige der Urkunden auf ominöse Weise wieder auf – so die Urkunde vom März 1260. Während einer Gastvorlesung von Prof. Coblenz in Marburg wurden diese ihm von Unbekannten zugespielt. Immer noch sind über 3000 Urkunden und Zehntausende Akten in den Sonderarchiven in Moskau und permanenter Anlass der Stadt Dresden, sich um die Rückführung nach mehr als 75 Jahren zu bemühen.
Thomas Kübler
Quelle: Stadtarchiv Dresden, 6.4.40.2 Stadtplanungsamt Bildstelle, II 10125, 1947
Februar 2022
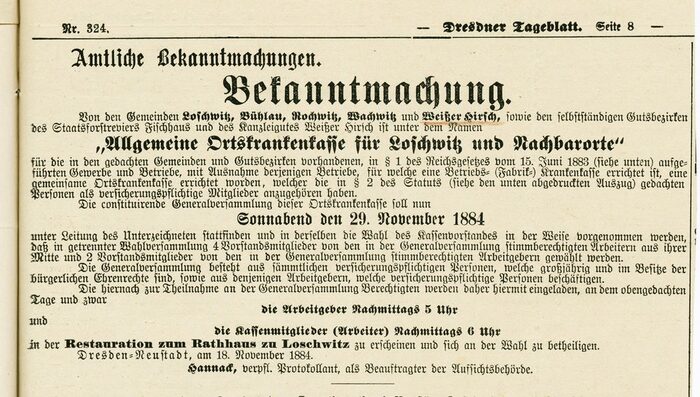
Archivalie zum Welttag der sozialen Gerechtigkeit
Die Vereinten Nationen riefen erstmals im Jahr 2009 den Welttag der sozialen Gerechtigkeit aus. Seitdem appellieren jährlich am 20. Februar verschiedene Institutionen die soziale Ungleichheit zu überwinden. Aus historischer Perspektive wurde das Armutsrisiko, das mit der sozialen Ungerechtigkeit einhergeht, vielfach diskutiert und in Teilen darauf reagiert. Beispielsweise im 19. Jahrhundert, in Folge der Industrialisierung, erreichten die sozialen Probleme einen Höhepunkt. Sichtbar wurde diese soziale Ungleichheit durch eine steigende Zahl Armer, Kranker und hilfsbedürftiger Menschen vor allem in den wachsenden Städten. Die Wohnungsnot, sehr schlechte Arbeitsbedingungen, Unterernährung und der daraus resultierende Anstieg von Krankheiten überforderten die Kommunen zunehmend. Traditionell war die Armenversorgung durch ein Mischsystem von kommunaler und kirchlicher Fürsorge gewährleistet worden. Im Zuge dieser unzureichenden Wohlfahrt entwickelte sich im 19. Jahrhundert auf der einen Seite das soziale Vereinswesen. Auf der anderen Seite führte die angespannte Situation zu einer Gründungswelle von Arbeitervereinen, deren Streiktätigkeiten bei den sozialistischen sowie sozialdemokratischen Parteien Unterstützung fanden. Im Jahr 1883 reagierte Otto von Bismarck mit der Sozialgesetzgebung zum Schutz der Arbeiter auf den steigenden Druck. Die Sozialgesetzgebung beinhaltete die Krankenversicherung, Unfallversicherung und Rentenversicherung. Die Archivalie des Stadtarchivs Dresden steht beispielhaft für die Umsetzung der Krankenversicherung. Die amtliche Bekanntmachung informierte über die Gründung der „Allgemeinen Ortskrankenkasse für Loschwitz und Nachbarorte“ im November 1884. Die „constituierende Generalversammlung“ sollte aus „sämmtlichen versicherungspflichtigen Personen […] sowie aus denjenigen Arbeitgebern bestehen, welche versicherungspflichtige Personen beschäftigen.“ Mit der heutigen gesetzlichen oder privaten Krankenkasse ist die erste Krankenversicherung von 1883 nicht vergleichbar. Der damalige Katalog sah Leistungen vor wie freie ärztliche Behandlung, freie Medikamente sowie Krankengeld ab dem dritten Tag von mindestens 50 Prozent des Lohnes für maximal 26 Wochen. Hinzu kam eine Unterstützung durch eine Wöchnerin für vier Wochen nach der Geburt und Sterbegeld in Höhe des 20-fachen Lohnes.
In den Beständen des Stadtarchivs Dresden befinden sich zahlreiche historische Unterlagen zu den Themenschwerpunkten wie Industrialisierung, Fürsorge- und Wohlfahrtssystem, Gesundheitswesen, die im Lesesaal ausgewertet werden können.
Annemarie Niering
Quelle: Stadtarchiv Dresden, 8.58 Weißer Hirsch, Nr. 249
Januar 2022
Gret Palucca zum 120. Geburtstag
Anlässlich des 120. Geburtstages von Gret Palucca erinnert das Stadtarchiv Dresden in der Serie Archivalie des Monats an das Leben und Wirken der Tänzerin. Die am 8. Januar 1902 in München geborene Margarethe Paluka eroberte bereits in den 1920er Jahren die Bühnen in Deutschland und im Ausland. Sie tanzte mit Mary Wigmann bis 1924, danach erfolgte ihre Solokarriere. Im „Berliner Abendblatt“ hieß es nach einem Auftritt am 6. November 1929: „Palucca tanzt – und ist herrlich wie je. Hier mündet der Tanz ins Leben ein. – Welche Einfachheit, welche Sparsamkeit in Gesten und Bewegungen. Wie wunderbar diese Vereinigung von Starkem und Zartem, von leidenschaftlichem Ausbruch und leisem Verlöschen, von dunkler Trauer und übermütiger Heiterkeit.“ Zu diesem Zeitpunkt lag die Gründung ihrer Dresdner Tanzschule bereits vier Jahre zurück. Gret Palucca unterrichtete unter anderen Tanztechnik, Improvisation, rhythmische Erziehung, Tanzgeschichte und Anatomie. Aufgrund ihrer jüdischen Herkunft und des Tanzstils wurde ihr die Vermittlung von Freien Tanz während des Nationalsozialismus verboten. Bis 1944 übernahmen Adolf Havlik und Eva Glaser die Leitung der Schule. Kurz nach Kriegsende, im Juli 1945, eröffnete Palucca ihre Schule erneut. Vier Jahre später wurde diese verstaatlicht und bekam den Status einer Fachschule für künstlerischen Tanz. Ihr Amt als Schulleiterin legte sie 1952 wegen Einmischung der Staatlichen Kommission für Kunstangelegenheiten nieder. In den folgenden Jahren erfolgte die Berufung von Gret Palucca als künstlerische Leiterin und sie unterrichtete bis kurz vor ihrem Tod. Sie stirbt am 22. März 1993 in Dresden mit dem Wunsch auf der Insel Hiddensee beigesetzt zu werden.
Im Stadtarchiv ist ein Konvolut historischer Unterlagen über die Dresdner Tänzerin Gret Palucca und ihrer Tanzschule archiviert. Die Archivalie des Monats zeigt eine Kinder-Tanzgruppe mit Palucca aus den 1980er Jahren. Die Fotografie befindet sich aktuell in der Ausstellung „Günter Ackermann – Fotografie“ im Stadtarchiv Dresden. Aufgrund der Schließung durch die Corona-Notfall-Verordnung wurde die Fotoausstellung auf der Elisabeth-Boer-Str. 1 bis zum März 2022 verlängert.
Annemarie Niering
Quelle: Stadtarchiv Dresden, 17.6.2.30, Bildarchiv, Günter Ackermann.
Archivalien des Monats aus dem Jahr 2021
Dezember 2021

„Weihnachtsfreude auch den Verkaufsangestellten.“ Eine kurze Geschichte der Ladenöffnungszeiten am Heiligabend
Geregelte Ladenöffnungszeiten und ein gesetzlich vorgeschriebener Ladenschluss um 14 Uhr am Heiligabend sind für uns heute selbstverständlich. Dass dies keineswegs schon immer so gewesen ist, zeigt die Archivale des Monats Dezember. Im Bestand des Dresdner Frauenvereins befindet sich ein Aufruf, der dafür warb, das Verkaufspersonal bei dessen Einsatz für einen Ladenschluss um 17 Uhr am 24. Dezember 1928 zu unterstützen.
Historischer Hintergrund der Petition waren die umfänglichen Arbeits- und Öffnungszeiten, die sich aus der allgemeinen Gewerbefreiheit des seit 1871 bestehenden Deutschen Kaiserreiches ergaben. Mehrheitlich öffneten die Geschäfte morgens um fünf Uhr und schlossen zum Teil erst um 23 Uhr. Auch an Sonntagen wurde gearbeitet, unterbrochen ausschließlich für die Zeit des Gottesdienstes. Erste Zeitvorgaben entstanden durch die von den Gewerkschaften und der Sozialdemokratie formulierten Forderungen nach Arbeitszeitregelung und Gesundheitsschutz für Angestellte. 1891 wurde der Verkauf an Sonn- und Feiertagen ein-geschränkt. Ausnahmen galten für Kioske, Lebensmittel- und Blumenläden sowie Bäckereien. Um 1911 wurde mittels freiwilliger Absprachen zwischen den Kaufleuten in Großstädten und vielen Gemeinden die werktägliche Einkaufszeit bis 20 Uhr festgelegt. Eine neue gesetzliche Regelung führte ab 1919 die Sonntagsruhe ein und verringerte die Ladenöffnungszeiten an Werktagen auf die Zeit von sieben bis 19 Uhr. Diese Verkürzungen galten allerdings nicht für die Woche vor Weihnachten, sodass sich der „Gewerkschaftsbund der Angestellten“ gemeinschaftlich mit dem „Verband der weiblichen Handels- und Büroangestellten“ an den Stadtbund der Dresdner Frauenvereine wandte, um für eine Schließung der Verkaufsstellen um 17 Uhr am Heiligabend zu werben. Entsprechend der Darstellung und dem Slogan auf den Handzetteln sollten insbesondere „Hausfrauen“ dazu animiert werden, die Weihnachtseinkäufe vorfristig und nicht erst in den Abendstunden zu verrichten. Darüber hinaus konnte mittels Unterschrift das Anliegen ganz direkt unterstützt werden. Auch wenn die Kampagne anfangs erfolglos blieb, entwickelte sich über die nachfolgenden Jahrzehnte eine stetige Verbesserung der Arbeitszeitregelung am Weihnachtstag. Während in der DDR-Zeit die Öffnungszeiten, im Gegensatz zur Bundesrepublik, regional separat festgelegt waren, regelt heute der Sonn- und Feiertagsschutz des bundesweit geltenden Arbeitszeitgesetzes einen pünktlichen Ladenschluss am Weihnachtstag um 14 Uhr.
Sylvia Drebinger-Pieper
Quelle: Stadtarchiv Dresden, 13.28 Dresdner Frauenverein, Nr. 5, S. 123.
November 2021

Der Eiswurm – ein Dresdner Markenzeichen.
Vieles deutet auf die Existenz des Eiswurms in Dresden hin: Am Eiswurmlager, Eiswurm-Perle, Eiswurmpokal. Gemeint ist damit aber nicht das im Gletschereis vorkommende und wenig unterhaltsame Kleinlebewesen, sondern dasjenige Phantasiewesen der Brauerei zum Felsenkeller.
Die Felsenkellerbrauerei, zwischenzeitlich eine der größten Braustätten auf deutschem Gebiet, wurde 1856 als Aktiengesellschaft gegründet und bezog im Sommer 1858 ihr neues Areal entlang der Weißeritz im Plauenschen Grund. In die das Gelände flankierenden Felsen sprengte man die notwendigen kühlen Lagerkeller. Dort nun wohne der Eiswurm. Das jedenfalls gab 1862 ein Dresdner Bankiers in geselliger Runde zum Besten. Überdies, so die scherzhafte Zuspitzung, würde besagter Wurm am Kühleis lecken und damit der Haltbarkeit des Bieres schaden. Woraufhin ein ebenfalls zugegen gewesener Aktionär zuerst in Sorge, dann in Panik geriet, zur Brauerei raste, Alarm schlug und am Ende bloßgestellt war. Doch nicht nur Spott und eine heitere Geschichte blieben, sondern auch der Eiswurm, werbewirksam als Drache in feuerspeiender Pose in Szene gesetzt, als Markenzeichen der bis Ende 1990 bestehenden Felsenkellerbrauerei.
Wie das abgebildete Objekt andeutet, ist der Eiswurm auch im Breitensport anzutreffen, als Maskottchen und Auszeichnung der einstigen BSG Empor Felsenkeller Dresden, seit Herbst 1990 des SV Felsenkeller Dresden e.V. Neben vielen Aktivitäten wurde 1986 zum ersten Mal der bis heute sehr beliebte Eiswurmpokal ausgetragen, ein Mannschaftswettbewerb im Kinderturnen, ersonnen unter anderem von der langjährigen und im Juli 2021 für ihr Engagement mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichneten Vereinsvorsitzenden Christa Kay. Alle Teilnehmer erhielten einen kleinen roten Eiswurm aus Plastik, auch liebevoll Eiswürmchen genannt, die Sieger zudem einen Plüscheiswurm als Wandertrophäe. Wichtig dabei war und ist, dass alle gewürdigt werden. Nicht nur die ersten Plätze zählen. Sport soll vor allem Freude bereiten, aber auch der Umgang mit Niederlagen will erlernt werden. Er hält fit, ist gesellig und integrativ. So lautet bis heute die Philosophie des Vereins. Unter den Dresdner Vereinen ist der SV Felsenkeller „von den Großen der Kleinste und von den Kleinen der Größte“.
Alles in allem bleibt festzuhalten: der Eiswurm lebt, und an Vereine gewandt der Apell, dass nicht nur das Sporttreiben an sich, sondern auch die Überlieferung in Form von Fotos, Objekten, Urkunden, Wettkampfberichten, Ausflugsschilderungen, Chroniken und dergleichen mehr bedeutsam ist.
Patrick Maslowski
Quellen: Eiswurm-Figur (Stadtarchiv Dresden, 13.124 Sportverein Felsenkeller Dresden e.V., Nr. 54.); Zitat entnommen aus: Kay, Christa/ Reichert, Friedrich (Hrsg.): 70 Jahre Felsenkeller-Sport. Festschrift Sportverein Felsenkeller Dresden e.V., Dresden 2019. (Stadtarchiv Dresden, 13.124 Sportverein Felsenkeller Dresden e.V., Nr. 48.)
Oktober 2021
„..Dresdens poesievollster Heldensohn..“. 150 Jahre Theodor-Körner-Denkmal
Am Rande der St. Petersburger Straße schlummert unscheinbar ein Bronzestandbild von Theodor Körner (1791-1813). Das Denkmal wurde bereits am 18. Oktober 1871 eingeweiht und gehört damit zu den ältesten noch erhaltenen städtebaulichen Strukturen in diesem Areal überhaupt. Zur Identifikationsfigur wurde Körner durch seine patriotischen Gedichte und Lieder sowie durch seine Aufopferung während der Befreiungskriege. Anlässlich der Gedenkfeier zum 50. Todestag am 26. August 1863 wurden auf Initiative des Literarischen Vereins in Dresden ein „Körnercomité“ gegründet und erstmals Spenden für ein Denkmal gesammelt. Ursprünglich sollte das Werk bereits 1865 aufgestellt werden, aber der auserwählte Schöpfer, Professor Ernst Julius Hähnel (1811-1891), war lange Zeit verhindert. Hinsichtlich des Aufstellungsortes wurden sechs Möglichkeiten diskutiert, unter anderem ein Standort in der Nähe von Körners Geburtshaus in der Neustadt. Letztlich wurde der heutige Georgplatz auserkoren, insbesondere weil der Platz die erforderliche zentrale Lage und räumliche Ausdehnung aufwies. Körner war aber auch selbst Kreuzschüler gewesen und das Denkmal sollte im Besonderen die Aufmerksamkeit junger Menschen erwecken. Die Einweihung im Jahr 1871 war außerordentlich stark besucht: Allein über 600 Sänger leiteten die Feierlichkeit mit Liedern von Körner ein. Nach der anschließenden Rede des Oberbürgermeisters Friedrich Wilhelm Pfotenhauer wurde der bronzene Jüngling mit Liederschrift und Schwert enthüllt und erklärt: „vor uns steht in unverwelklicher Schöne [..] Dresdens poesievollster Heldensohn“.
Bei den Angriffen auf Dresden 1945 stürzte das Standbild zwar herab, blieb aber weitgehend unversehrt. Nach dem Krieg wurde es als „künstlerisch wertvoll“ eingestuft und schon am 18. Oktober 1952 im Rahmen einer „kurzen Feierstunde“ wieder aufgestellt. Mit Blick auf den “unglücklichen” Standort durch den Ausbau der Nord-Süd-Achse seit Mitte der 1960er Jahre erwog man zwar eine Umsetzung, aber es mangelte an einer überzeugenden Lösung. Das Erinnerungsspektrum des Denkmals hier an seinem historischen Standort dient maßgeblich als Orientierungspunkt für die frühere Bebauung des Platzes. An Körners Seite konnte sich im Übrigen auch eine Weiße Maulbeere bis heute behaupten, die vermutlich schon mit dem Kreuzschulneubau um 1866 eingepflanzt wurde und welche seit 1999 als Naturdenkmal ausgewiesen ist.
Johannes Wendt
Quelle: Stadtarchiv Dresden, 17.6.1, Ansichtskartensammlung, CH 003, o. J., unbekannter Fotograf, bearbeitet.
September 2021
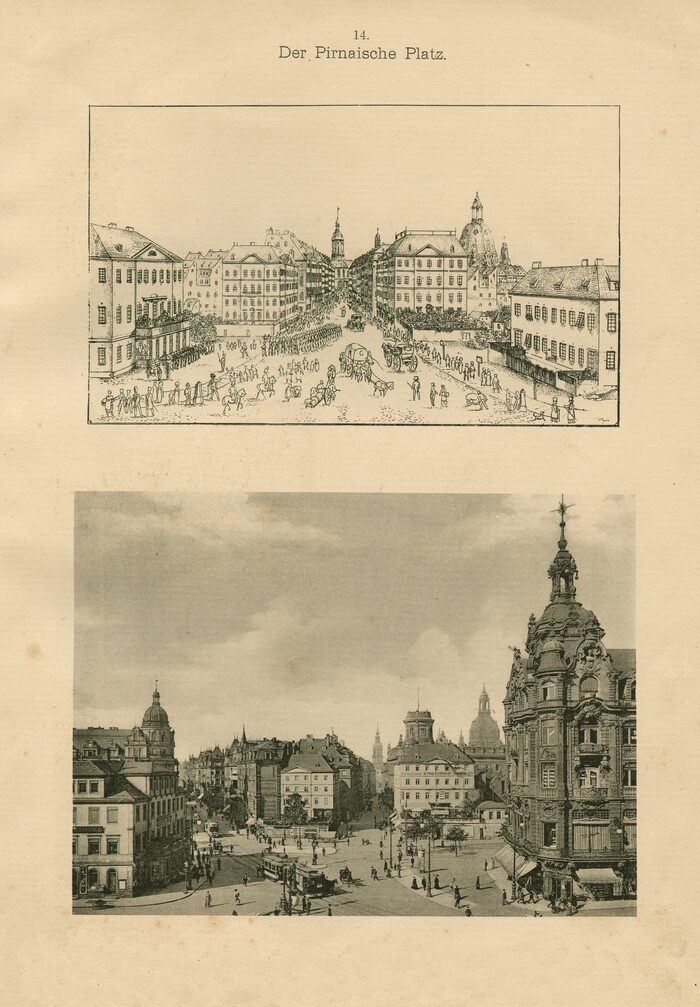
Historische Überlieferungen vom Stadtbild Dresdens. Eine Tradition geht weiter.
Die umfangreiche Dokumentation städtebaulicher Veränderungen mittels Fotografie weist für Dresden eine mehr als 150-jährige Tradition auf. Bereits die Fotografen der „frühen Stunde“ wie August Kotzsch (1813-1910) oder Hermann Krone (1827-1916) widmeten sich der Ablichtung baulicher Eigenheiten und Veränderungen ihres Lebensumfeldes. Eine erhöhte Nachfrage nach entsprechenden Aufnahmen wurde vor allem durch die zunehmend stadtgeschichtlich orientierte Gesellschaft generiert. Beispielhaft dafür steht der seit 1869 bestehende „Verein für Geschichte und Topographie Dresdens“, aus dem 1891 das Dresdner Stadtmuseum hervorging. Gründungsdirektor war der Historiker Otto Richter (1851-1922), der seit Juli 1879 bereits die Ratsbibliothek sowie das Ratsarchiv in Dresden leitete und intensiv an der Einrichtung einer Stadtbildsammlung arbeitete. Neben Zeichnungen, Grafiken, Lithographien und Kupferstichen beinhaltete die Sammlung zudem Fotokonvolute.
Eine Auswahl dieser Fotos wurde erstmals 1905, in der von Richter herausgegebenen Publikation „Dresden sonst und jetzt“, veröffentlicht. In diesem Buch bemühte sich Richter mittels Gegenüberstellung von historischen Grafiken aus den Jahren um 1830 mit Fotografien aus der Zeit um 1900 die Dokumentation der städtebaulichen Veränderungen Dresdens im 19. Jahrhundert darzustellen. Die didaktisch nüchtern erscheinende Darstellungsform verrät Richters kritischen Blick auf die zeitgenössischen Veränderungen. Bezogen auf die Herkunft der Bilder verweist er auf die Kunstanstalt Römmler & Jonas sowie auf das städtische Tiefbauamt. Wie sich die Zusammenarbeit zwischen Richter und dem Tiefbauamt genau gestaltete, ist nicht überliefert. Es steht jedoch fest, dass im Ergebnis eine einzigartige Langzeitdokumentation entstand, die in der ersten Hälfte der 1890er Jahre begann und Anfang der 1920er endete.
Der Ausbau der Stadtbildfotografie wurde durch Hans Erlwein (1871-1914) im Rahmen seiner Tätigkeit als Stadtbaurat weiter vorangetrieben. Die fortlaufende Pflege und Erweiterung des 1905 begonnenen Projektes „Stadtbildstelle“ endete im Jahr 1998. Das umfangreiche fotografische Material aus knapp neun Jahrzehnten wurde durch das Stadtplanungsamt digitalisiert und in einer Bilddatenbank zusammengefasst. Die Datenbank sowie die zugrundeliegenden Foto- und Negativbestände befinden sich seit 2017 im Stadtarchiv Dresden. Heute können wir mit Freude mitteilen, dass es dem Stadtarchiv in Zusammenarbeit mit Stadtbezirken gelungen ist, an die Tradition Richters anzuknüpfen. Bereits im August 2021 startete das Projekt „Stadtbildfotografie“, dass die fotografische Dokumentation Dresdens aufgreift und unsere Stadt im Jahr 2021/2022 für die Zukunft festhält.
Marco Iwanzeck
Quelle: Richter, Otto: Dresden sonst und jetzt: 50 Doppelbilder in Lichtdruck; nach alten Radierungen und neuen Aufnahmen. Römmler & Jonas, Dresden 1905.
August 2021
Kaufen Sie Ihr nächstes Musikinstrument ausschließlich im Fachhandel! Der Geigenhandel um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert
Das aktuelle Archivale des Monats, ein zwölf Seiten umfassendes Heft in Postkartengröße mit dem Titel „Der Geigenhandel, wie er ist und wie er zu wünschen wäre. Ein Mahnwort an Künstler und Kunstfreunde“, stammt aus der Feder von Heinrich August Paulus, dem Inhaber der Dresdner Geigenbaufirma Richard Weichold. Das Unternehmen war im Jahr 1834 von dem Königlich Sächsischen Hof-Instrumentenmacher Friedrich August Weichold gegründet und später durch den Sohn Richard Weichold übernommen worden, dessen Namen sie fortan trug. Unter seiner Leitung errang die Firma Weltruf; insbesondere galt er als einer der herausragenden deutschen Bogenbauer des späten 19. Jahrhunderts.
Heinrich August Paulus berichtet in besagter Broschüre, dass in den breiten Schichten des Volkes über den Wert der Geigen die wunderbarsten Vorstellungen herrschten; dass von neuen Instrumenten nicht viel gehalten, in jeder einigermaßen alt erscheinenden Geige aber ein Gegenstand von besonderem Wert gewittert würde: „Märchenhafte Erzählungen von kostbaren zufälligen Geigenfunden, durch welche mühelos ein Vermögen erworben wurde, finden gläubige Hörer, und viele Laien, Dilettanten und selbst Künstler hegen den lebhaften Wunsch, doch auch einmal durch die Gunst des Zufalls in den Besitz eines solchen Schatzes zu gelangen.“
Statt also eine neu gebaute Meistergeige beim Geigenmacher zu erstehen, erwarben Musikinteressierte bevorzugt ein scheinbar altes Instrument bei einem Gelegenheitskauf – ein angeblich aus einem Kloster stammendes Cello oder eine Geige von einem entfernten Verwandten, „der als Kammermusiker in Russland starb, das Instrument aber bis zu seinem Tode in hohen Ehren hielt und es trotz aller Not nicht veräussern wollte.“ Paulus appelliert an die Leserschaft, ob nicht eine vorzügliche, neue Meistergeige einer alten, schlecht erhaltenen, von zweifelhaftem Wert vorzuziehen sei: „Der Ankauf eines von mir gefertigten Erzeugnisses der Geigenbaukunst wird den Beweis liefern, dass auch in unseren Tagen auf diesem Gebiete Vollwertiges geschaffen werden kann.“
Wie die angesprochenen Künstler und Kunstfreunde auf das Mahnwort reagierten, ist nicht überliefert. Die Firma Richard Weichold jedoch bestand bis zum Jahr 1945.
Claudia Richert
Quelle: 17.4.1 Drucksammlung, Kapsel 283, Geschäftsempfehlungen „W“
Juli 2021
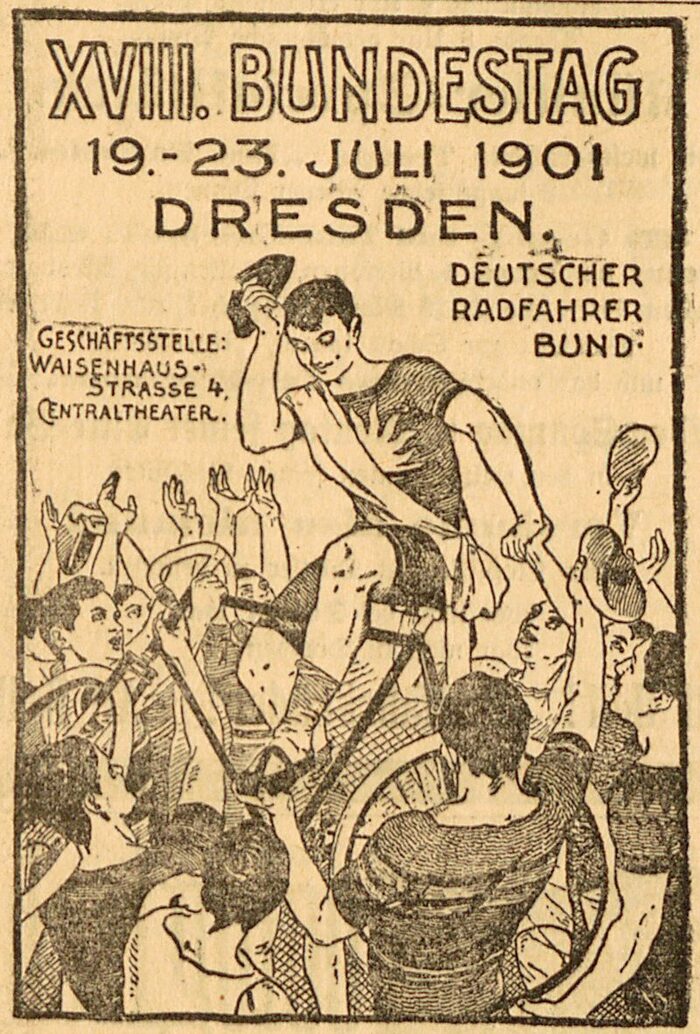
„Das Leben und Treiben stand unter dem Zeichen der Radfahrer“. Der 18. Bundestag des Deutschen Radfahrbundes in Dresden
Vor 120 Jahren fand vom 19. bis zum 23. Juli 1901 das 18. Bundesfest des Deutschen Radfahrerbundes in Dresden statt. Den Ehrenvorsitz für diese Veranstaltung übernahm der Oberbürgermeister Gustav Otto Beutler. Die Organisatoren Max Ullrich und Emil Ahlhelm gingen von mindestens 15.000 Besuchern aus, die vor allem den großen Festzug am Sonntag, den 21. Juli 1901, sehen wollten. Der Zug begann um 11 Uhr an der Stübelallee und ging über die Lennéstraße, den Altmarkt durch die Wilsdruffer Straße und dem Postplatz bis zum damaligen Wettiner Bahnhof – heute Bahnhof Mitte. Etwa 2400 Radler nahmen am Festzug teil. Der Dresdner Anzeiger vom darauffolgenden Montag berichtete, dass „das Publikum an dem Sportschauspiel, das für Dresden etwas Neues, in solch großem Rahmen noch nicht Gebotenes war, regen Anteil nahm“.
Mit den Festveranstaltungen waren auch zahlreiche Radwettrennen verbunden. Bereits am 16. März 1901 hatte sich der „Verein für Radwettfahrten zu Dresden“ gegründet, um den Bau einer Bahn zu befördern. Die neue Wettkampfbahn entstand noch vor dem Radfahrfest im Birkenwäldchen an der Fürstenstraße im Stadtteil Johannstadt und wurde am 7. Juli 1901 eröffnet. Auf der neuerbauten Bahn fanden am Festwochenende zahlreiche Wettrennen statt. So gab es Meisterschaften über einen, zwei und fünf Kilometer auf dem Niederrad sowie „Mehrsitzer-Vorgabefahren“. Neben den Bahnrennen gab es noch Disziplinen im Kunstfahren auf dem Hochrad sowie im Reigenfahren.
1915 lud die Stadt abermals den Deutschen Radfahrerbund ein, um die Bundesversammlung in Dresden durchzuführen. Der Radsportbund zählte zu diesem Zeitpunkt circa 50.000 Mitglieder. Neben Dresden stellte auch Düsseldorf einen Antrag den Bundestag durchzuführen. Geplant war das Treffen für den 23. Mai bis 27. Mai 1915 . Nachdem Dresden noch im Juli 1914 den Zuschlag zur Ausrichtung erhalten hatte, wurde das Radahrfest im November 1914 aufgrund des 1. Weltkrieges und der damit verbundenen wirtschaftlichen Folgen abgesagt. Für die nächsten Jahre fand kein Bundestag des Deutschen Radfahrbundes mehr statt. Das 1915 ausgefallene Bundesfest des Deutschen Radfahrerbundes konnte 1926 in Dresden nachgeholt werden.
Marco Iwanzeck
Quellen: Stadtarchiv Dresden 2.3.1 Hauptkanzlei, Nr. 189.
Stadtarchiv Dresden 18. Bibliothek, Dresdner Anzeiger vom 22. Juli 1901.
Juni 2021
Sensation: Eine neue Desinfektionsmethode. Karl August Lingner und sein Wirken im städtischen Desinfektionswesen
An Desinfektionsmittelspender, die gerade in der jetzigen Pandemie vor jeder Tür stehen, war vor gut 124 Jahren ebenso wenig zu denken wie an multiresistente Keime. Dabei wurde in Zeiten von Tuberkulose, Diphterie, Pocken und Cholera die Bedeutung und Wirkung einer gründlichen Desinfektion immer deutlicher. Seit der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde händeringend nach einer geeigneten Lösung zur Bekämpfung von Krankheitserregern gesucht. Denn im Zuge des wissenschaftlichen Fortschritts wurde der Zusammenhang zwischen Mikroorganismen und den ausbrechenden Seuchen und Krankheiten erkannt. Alle bisherigen Methoden zur Raumdesinfizierung brachten nicht den gewünschten Effekt. Umso bedeutender war daher die Entwicklung des Lingner‘schen Desinfektionsapparates im Jahre 1897. Beworben wurde dieser Apparat, der in der Lage war Krankenhauszimmer, Wohnräume und sogar Ställe in nur drei Stunden tiefenwirksam keimfrei zu machen und gleichzeitig Oberflächen nicht anzugreifen, mittels umfangreicher Werbekampagnen. Ein Beispiel dafür bildet ein Werbefaltblatt aus dem Bestand der Gemeinde Torna – unser Archivale des Monats Juni.
Die Grundlage für das Gerät bildete das von R. Walther und Dr. A. Schlossmann vom organisch-chemischen Laboratorium der Technischen Hochschule Dresden ebenfalls 1897 entwickelte Desinfektionsmittel Glycoformal. Die Mischung aus Formaldehyd, Glycerin und Wasser verdunstete nicht einfach, sondern drang in die mit Keimen bedeckten Oberflächen ein und vernichtete alle Erreger. Karl August Lingner (1861–1916), Erfinder und Namensgeber des Lingner‘schen Desinfektionsapparates sowie Vermarkter der bekannten Mundspülung „Odol“, ließ den Apparat in seinem Werk „Dresdner Chemisches Laboratorium Lingner“ herstellen. In dem Faltblatt vom Juli 1898 wird die Funktionsweise wie folgt beschrieben. „Dieser Apparat besteht aus einem Ringkessel (B), in welchem Wasser zum Sieden gebracht wird. Der Wasserdampf steigt alsdann in ein Reservoir (A), das mit Glycoformal angefüllt ist. Es wird nun durch vier Düsen (d), die nach verschiedenen Richtungen aus dem Reservoir herausführen, durch den Wasserdampf das Glycoformal intensiv vernebelt und hinausgeschleudert.“ Nach ausgiebigem Lüften sind die Räume sofort wieder uneingeschränkt benutzbar. Die leichte Handhabung ermöglicht eine unkomplizierte und schnelle Einsatzbereitschaft, die überall möglich ist. Nach ausführlichen Tests wurde der Desinfektionsapparat schließlich für den Handel freigegeben und kostete 80 Mark.
Am 10. März 1901 empfahl auch die Königliche Amtshauptmannschaft Dresden-Altstadt die Verwendung des Desinfektionsgerätes. Im gleichen Jahr unterbreitet Lingner den Vorschlag, eine Desinfektionsanstalt in Dresden zu errichten. Dabei bezog er sich auf die Choleraepidemie 1892 in Hamburg. Die Gründung der dortigen Anstalt hatte unzähligen Bürgern das Leben gerettet und die Epidemie gestoppt. Die Kosten für die Errichtung einer Desinfektionszentrale in Dresden übernahm Lingner selbst. Bereits im Juli 1901 wurde die „Öffentliche Zentralstelle für Desinfektion“ eröffnet. Es handelte sich um ein hochmodernes Institut, dessen Konzept die Vorzüge sowie die festgestellten Mängel anderer Einrichtungen miteinander verband. Neben den Aufgaben zur Desinfektion von Wohnräumen, Kleidung und Gebrauchsgegenständen gehörte ab 1902 auch die Ausbildung von Desinfektoren aus allen Städten Sachsens dazu. Damit wurde eine der ersten deutschen Desinfektorenschulen gegründet, die bis heute fortbesteht, seit 1965 jedoch mit Sitz in Leipzig. Ab 1906 gehörte die Anstalt zur öffentlichen Verwaltung. Ihre Arbeit wird heute durch die Dresden Schädlingsbekämpfung und Kommunalhygiene GmbH fortgesetzt. So gilt damals wie heute: Vorsorge ist eben besser als Nachsorge.
Susanne Koch
Quellen: Stadtarchiv Dresden, Bestand 8.53 Gemeindeverwaltung Torna, Sign. 49.
Mai 2021
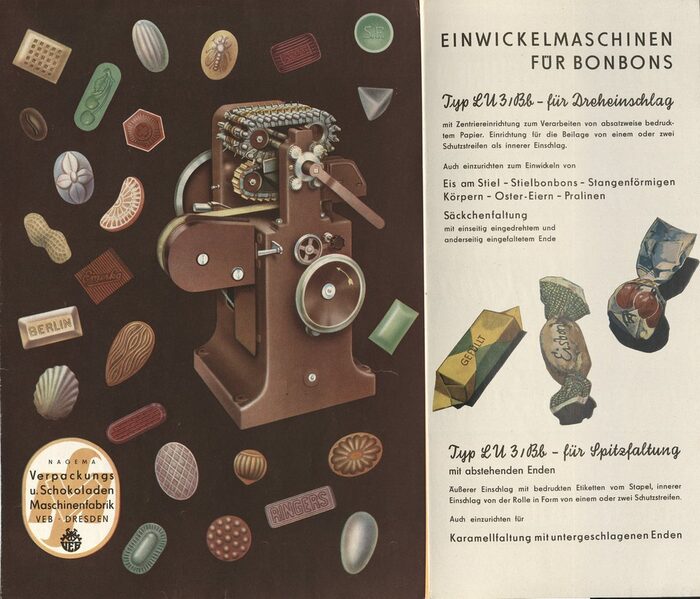
Kulturgut Verpackung – Dresden als Zentrum der Verpackungsindustrie
Ob Pralinenschachtel, Suppentüte oder Waschpulverkarton – Verpackungen und Markenlabels funktionieren über Wiederkennungseffekte und werden oft zu persönlichen und kollektiven Erinnerungsträgern ganzer Generationen. Sie erst erschaffen gewissermaßen ein Produkt, wie beispielsweise die berühmte ODOL-Flasche Lingners.
Für die Zeit der Moderne werden Warenverpackungen zunehmend als wichtige Quellen für die Alltags-, Konsum-, Design-, Industrie- und Handelsgeschichte erkannt und erhalten einen eigenständigen Kultur- und Sammlungswert. Das Stadtarchiv Dresden bewahrt mit Sammlungen zum Dresdner Verpackungsmaschinenbau und mit dem Betriebsarchiv des VEB Polypack und seiner Vorgängerunternehmen umfangreiche Bestände zur Geschichte des Verpackungswesens. Dazu gehört auch eine bedeutende Mustersammlung von Warenverpackungen der DDR aus Polypack-Produktion. Exemplarisch für diesen bedeutenden Teil Dresdner Industriegeschichte präsentieren wir in diesem Monat ein Messeprospekt für eine Süßwarenverpackungsmaschine des VEB Verpackungs- und Schokoladenmaschinenfabrik NAGEMA in Dresden aus der Zeit um 1955.
Dass der Raum Dresden sich frühzeitig zu einem innovativen Zentrum der deutschen Papierverarbeitungs- und Verpackungsindustrie entwickeln konnte, ist dem Zusammenspiel verschiedener Faktoren zu verdanken: Die Residenzstadt war wichtiger Standort einer verpackungsintensiven Kolonial-, Genuss- und Luxuswarenfabrikation in Deutschland. Das sich früh industrialisierende Sachsen bildete zudem ein Zentrum des Maschinenbaus, welches zeitig auf neue Entwicklungen im Bereich der Papierherstellung und -verarbeitung reagierte. Namhafte Unternehmen machten den Großraum Dresden um 1900 zu einem bedeutenden Fabrikationsort für Papiermaschinen. Firmen wie Universelle, Loesch, Gäbel und andere bemühten sich in teils enger Zusammenarbeit mit der Dresdner Tabak- und Schokoladenindustrie um die Entwicklung und Herstellung fortschrittlicher Verpackungsmaschinen.
Im Anschluss an diese breite Vorkriegstradition blieb der Standort Dresden trotz reparationsbedingter Demontagen, Verstaatlichung der Betriebe und Abwanderung vieler Unternehmerfamilien in der DDR-Zeit erhalten. So entstand 1950 der VEB Schokoladen- und Verpackungsmaschinen Dresden, auch „Schokopack“ genannt, durch die Vereinigung von Maschinenbaufirmen des Dresdner Ballungsraums. 1972 bildete sich durch die Zusammenlegung des VEB Schokopack und des VEB Tabakuni, als der Nachfolgefirma von Universelle Zigarettenmaschinen, der VEB Verpackungsmaschinenbau Dresden. Dieser war bis 1990 der Leitbetrieb des Kombinates Nahrungs- und Genussmittelmaschinenbau NAGEMA.
Im Rahmen der Archivale des Monats sowie als Teilbereich der Ausstellung „Verpacktes Wissen. Wir konservieren Stadtgeschichte“, welche vom 17. Mai bis 24. September 2021 im Stadtarchiv Dresden zu sehen ist, sollen u.a. interessante Einblicke in die Sammlung historischer Warenverpackungen und in die sich mit ihnen verbindenden Aspekte deutscher und Dresdner Industriegeschichte gewährt werden. In der Konfrontation mit populären Warenverpackungen der Vergangenheit können Sie dann selbst einmal austesten, inwieweit Ihr persönliches Erinnern auch über das Kulturgut Verpackung funktioniert.
Stefan Dornheim
Quellen: Stadtarchiv Dresden, Bestand 13.72 Förderverein für Wissenschaftler, Ingenieure und Marketing Dresden e.V. (WIMAD), Nr. 18 Verpackungsmaschinenbau NAGEMA. Stadtarchiv Dresden, Bestand 9.1.30 Aktiengesellschaft für Kartonagenindustrie/Polypack.
April 2021
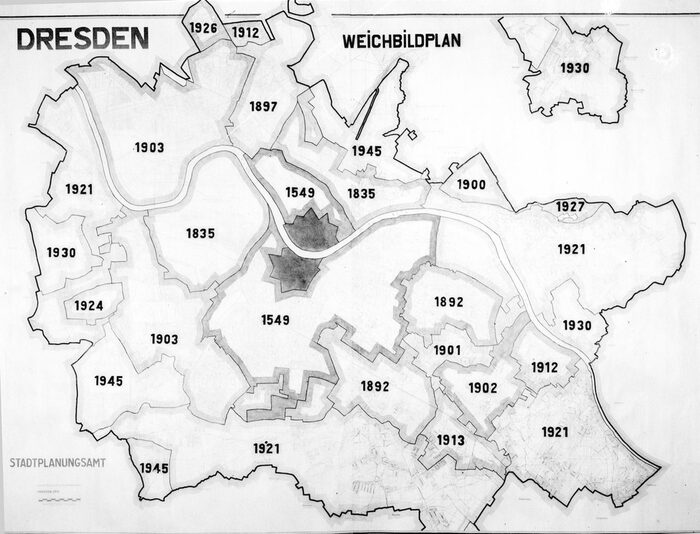
Zweite Eingemeindungswelle 1921 erfasste mehr als 20 Orte. Vor 100 Jahren dehnte die Stadt Dresden ihre Grenzen aus wie nie zuvor
Im Jahre 1921 – vor genau 100 Jahren dehnte die Stadt Dresden ihre Grenzen aus wie nie zuvor. Grund dafür waren die Eingemeindungen von vormals eigenständigen Orten. Zwar gab es vorher auch Einverleibungen – so mitunter der Sprachgebrauch – nach Dresden, aber nicht in diesem Ausmaß.
Von 1836 bis 1999 wurden insgesamt 65 Landgemeinden, vier Gutsbezirke sowie die Stadt Klotzsche nach Dresden eingemeindet. Es gab vier große Eingemeindungswellen: 1903, 1921, 1950 und nach 1990.
Die erste Eingemeindung war der Anschluss von Altendresden (Innere Neustadt) im Jahr 1549. Für mehr als zwei Jahrhunderte veränderte sich das Stadtgebiet durch die Anlage von Festungsbauten kaum. Erst mit Schleifung der Bastionen, die die Stadt nach außen schützten, aber gleichzeitig jede Ausdehnung verhinderten, erweiterte sich Dresden in den 1830er Jahren über das so genannte Weichbild. Dies betraf vor allem die Friedrichstadt, die Radeberger Vorstadt, die Antonstadt und die Leipziger Vorstadt. Zum Ende des 19. Jahrhunderts nahmen die Eingemeindungsbestrebungen wieder Fahrt auf. Striesen und Strehlen wurden schon 1892 sowie Pieschen, Wilder Mann und Trachenberge 1897 angeschlossen. 1901 folgten Gruna ein Jahr später Räcknitz, Seidnitz und Zschertnitz. Mit der ersten großen Eingemeindungswelle im Jahr 1903 kamen Cotta, Kaditz, Löbtau, Mickten, Naußlitz, Plauen, Trachau, Übigau und Wölfnitz zu Dresden. Nach einer kurzen Unterbrechung waren auch Tolkewitz (1912) und Reick (1913) bereit, sich unter die Haube der sächsischen Hauptstadt zu begeben.
Gemeindegrenzen änderten sich insbesondere in Zeiten gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Umwälzungen. Häufig gingen Eingemeindungen mit einer dramatischen Entwicklung in Politik und Wirtschaft einher. Einer solchen Krise folgte auch die Eingemeindungswelle von 1921. Der Erste Weltkrieg bescherte der Bevölkerung viele Sorgen und Nöte und für die Gemeinden waren wirtschaftliche Einbrüche nicht zu verhindern. Mancher Ort wollte sich freiwillig Dresden anschließen, andere wiederum versuchten, die Eingemeindung unter allen Umständen zu vermeiden. Am 1. April 1921 kam es dann zur Massenvermählung von Dresden und den Gemeinden Blasewitz, Briesnitz, Bühlau, Coschütz, Dobritz, Gostritz, Kaitz, Kemnitz, Kleinpestitz, Kleinzschachwitz, Laubegast, Leuben, Leutewitz, Loschwitz, Mockritz, Niedergorbitz, Obergorbitz, Rochwitz, Stetzsch und dem mondänen Weißen Hirsch.
An besagtem Tag wurden vormittags von jeder der betroffenen Gemeinden ein besoldetes Ratsmitglied entsandt, begleitet von mehreren unbesoldeten Ratsleuten mit einem Schriftführer. Nach der „Ordnung für die Übernahmefeiern in den Gemeinden“ übernahm dann Oberbürgermeister Bernhard Blüher in Bühlau, Weißer Hirsch und Rochwitz zwischen 9 und 12 Uhr persönlich die Verwaltungsgeschäfte. Taggleich wurden von anderen Bürgermeistern und Stadträten die Verwaltungsgeschäfte in den nun eingemeindeten Orten übernommen. Blasewitz, Loschwitz und der Weiße Hirsch wehrten sich bis zuletzt gegen die Aufgabe ihrer Selbstständigkeit. Aus der langen Auseinandersetzung gingen die Befürworter siegreich hervor. Am 1. Oktober 1921 bestätigte das Sächsische Ministerium des Inneren die Eingemeindung der drei Orte.
Inzwischen erfasste die Eingemeindungswelle 1921 drei weitere Orte: Ebenfalls zu Dresden kamen am 1. Juni Leubnitz-Neuostra, Prohlis und Torna hinzu. Dreißig Jahre später sollte die nächste Eingemeindungswelle folgen.
Quellen: Stadtarchiv Dresden, 6.4.40.1 Stadtplanungsamt Bildstelle, Nr. XIII3991, 1949.
Wie ein angekündigter Aprilscherz zu Mord und Brandstiftung wurde. Die Verbrechen des Johann Gottlieb Reichel am 1. April 1816
Als Aprilscherz wird laut Duden „Spaß“ oder „Ulk“ definiert, mit dem jemand in den April geschickt wird. Eher als makabrer Scherz ist das zu verstehen, was am 1. April 1816 geschah. Im Bereich der Amtsgemeinde Neuer Anbau, ab 1832 als Stadtteil Antonstadt bekannt, ereignete sich an diesem Tag ein Familiendrama. Darüber berichtete die ausführliche Anzeige des Polizey-Collegii vom 2. April 1816 - das Archivale des Monats April 2021.
Zunächst deutete nicht viel darauf hin, dass an diesem Tage etwas Grauenhaftes geschehen sollte. Morgens frühstückte Johann Gottlieb Reichel „in Ruhe und mit Appetit“, ehe er nach 6 Uhr das Haus verließ. Nachdem der Zimmermann sich bei einem Herrn Kiesling in der Weißengasse unter Vorspiegelung falscher Tatsachen Zutritt zu dessen Boden verschafft hatte, legte er dort Feuer, wodurch auch eine Stube im Haus abbrannte. Er begab sich anschließend zum Gehöft eines Herrn Huhle, wo er brennenden Schwamm und Schwefel in einer Lade mit Stroh versteckte. Dieses fing glücklicherweise kein Feuer. Besagtes Stroh legte er nahe der Gebäude ab. Nach dieser Tat setzte er das in der Nachbarschaft zu seinem eigenen Haus gelegene Heim seiner Schwiegereltern in Brand. Er drang, bewaffnet mit einem Säbel ins Haus ein, wo ihm zuerst die 60-jährige Schwiegermutter zum Opfer fiel. Dieser schlug er in den Kopf, das Rückgrat und die Arme. Dem 75-jährigen Schwiegervater, der hinter einer Kinderwiege stand, trennte er den Arm und zwei Finger einer Hand ab. Seine hochschwangere Ehefrau, die durch den Lärm herbeigeeilt kam, erstach er. Auf seiner Flucht tötete er außerdem zwei im Stall befindliche Pferde, ehe er sich mittels einer alten Pistole selbst richtete.
Im Dresdner Anzeiger war vier Tage später, am 5. April 1816, zu lesen, dass der Körper des Mörders und Brandstifters Johann Gottlieb Reichel am selben Tage durch den Knecht des Scharfrichters „auf den Richtplatz gebracht und dort verscharret“ wurde. Seine Schwiegereltern befanden sich zu dieser Zeit schwerverletzt im Stadtkrankenhaus. Lediglich sein einziges Kind, eine zweijährige Tochter, blieb unverletzt.
Offen blieb das Motiv für diese Taten. Eine Erklärung könnte sein, dass Reichels Schwiegermutter ihn wegen Holzdiebstählen angezeigt hatte. Die als „zanksüchtig“ und „boshaftig“ beschriebene Frau war jedoch selber wegen kleinerer Marktdiebstähle bekannt. Aufgrund der Anschuldigungen wurde Reichel für den 1. April in das Justizamt vorgeladen, um rechtlich belangt zu werden. Soweit kam es jedoch nicht, da er, wie am Tag zuvor in einer Bierschänke verkündet: „die ganze Gemeinde zum Ersten April“ schickte.
Patricia Ottilie
Quellen: Stadtarchiv Dresden, 17.5, Handschriftensammlung, Hs 1921/22.8.2318
Stadtarchiv Dresden, 18, Wissenschaftlich-Stadtgeschichtliche Fachbibliothek, Zt. 1, Dresdner Anzeiger, Nr. 38 vom 5. April 1816
März 2021
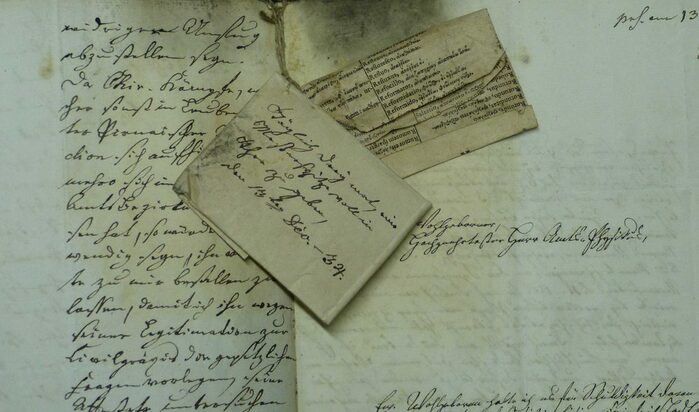
Wenn es juckt und brennt, fragen Sie einen Arzt oder Apotheker – aber bitte einen Seriösen. Zum illegalen Medikamentenhandel in der Dresdner Friedrichstadt um 1835
In Zeiten der anhaltenden Corona-Pandemie richten sich die Fragen zum Umgang mit Krankheiten und den damit einhergehenden Folgen nicht nur an die medizinische Wissenschaft und Forschung, sondern zunehmend auch an den Erfahrungsschatz der Geschichtswissenschaft. Im Zuge von Recherchen nach pandemiebezogenen Quellen im Stadtarchiv Dresden gelang den Mitarbeitern ein kleiner Sensationsfund.
Sie entdeckten, dass eine Akte aus dem Ratsarchiv mit dem Titel „Acta von Handel mit Medikamenten“ zwei kleine papierne Faltumschläge enthält. Der Inhalt war durchaus überraschend, handelt es sich doch um eine Teemischung sowie um ein Pulver zur Behandlung von Skabies, umgangssprachlich Krätze genannt. Erste Erkenntnisse zur Erforschung dieser Krankheit gelangen dem italienischen Forscher Giovanni Cosimo Bonomo (1666 bis 1696), der mittels Mikroskop ein kleines Tierchen entdeckte, das sich in der Oberschicht der Haut verbarg und als Verursacher der Beschwerden identifiziert werden konnte. Aus den neuen Informationen eine Behandlungsstrategie abzuleiten, vermochte allerdings erst der Wiener Mediziner Ferdinand von Hebra (1816-1880) um 1850. Bis dahin musste auf Rezepturen zurückgegriffen werden, die bereits seit dem Mittelalter im Umlauf waren und für alle Anbietenden ein gutes Geschäft bedeuteten.
Im vorliegenden Fall verkaufte ein selbsternannter „Ober-Wundarzt“ namens Kämpfe, wohnhaft in der Friedrichstadt im Haus Nr. 43 neben der Apotheke, ein Mittel gegen besagte Krätze. Um sich von dem juckenden und quälenden Übel zu befreien, zahlten die Käufer kleine Vermögen, weit über ihre Zahlungsfähigkeit hinaus. Aufmerksam auf diese Machenschaften wurde ein Arzt namens Gustav Friedrich Gruner durch einen medizinischen Notfall in der Weißeritzstraße 64. Nachdem sich die unter Nervenfieber leidende Patientin erholt hatte, berichtete sie Gruner, dass sie Medikamente eingenommen habe, die ihr Ehemann aufgrund seines Krätzleidens von oben benanntem Kämpfe gekauft hatte. Nachdem der Arzt wenige Tage später erneut in das Haus auf der Weißeritzstraße gerufen wurde, um einen 7-jährigen Jungen gegen ein Hautleiden zu behandeln, kam auch hier das Gespräch auf diese Medikamente. Laut Angabe der Pflegemutter war die Behandlung erfolgreich und der Hautausschlag zurückgegangen, der Gesundheitszustand des Kindes aber kritisch und das Vermögen der Familie aufgebraucht. Die Dame überließ dem Arzt die Tee- und Pulverproben, die Gruner in der hiesigen Apotheke analysieren ließ. Da der Preis für die einzelnen Bestandteile keineswegs gerechtfertigt war, ging Gruner davon aus, dass es sich bei vorliegender Sache um „bedeutenden Wucher“ und „Geldprellerey“ handle. Auch die hohe Qualität machte Gruner skeptisch, sodass der Arzt einen professionellen Hintergrund vermutete, bei dem gut wirksame Medikamente zusammengemischt wurden. Das daraus resultierende Heilmittel als Ganzes aber wurde weit über Wert verkauft. Zudem stand es keineswegs jedem Arzt oder Apotheker frei, Medikamente in Umlauf zu bringen. Aus diesem Grund formulierte am 13. Januar 1835 der Arzt Gruner beim Dresdner Amtsphysikus, gemeint ist damit ein approbierter Arzt, der auf einer amtlichen Stelle der städtischen Gesundheitsverwaltung tätig war, eine Beschwerde. Damit sich der Amtsphysikus selbst vom dargelegten Tatbestand ein Bild machen konnte, übersandte Gruner die heute noch erhalten zwei Päckchen an den Rat der Stadt Dresden.
Welche Ingredienzen zur Herstellung des erfolgreichen Krätzheilmittels notwendig sind und ob der Beklagte Kämpfe tatsächlich eine Rechtswidrigkeit begangen hat, kann nur ein Blick in die Akte verraten.
Sylvia Drebinger-Pieper
Quelle: Stadtarchiv Dresden 2.1.5 F.XVI.102 u
Februar 2021

Spitzensport in Dresden. Der SC Einheit Dresden und seine Olympiateilnehmer 1972.
Die Olympischen Spiele gehören zweifellos zu den Höhepunkten im Leben eines Sportlers. Alle vier Jahre werden wenige von ihnen ausgewählt, sich in den Wettkämpfen zu beweisen. Vom 26. August bis zum 11. September 1972 fanden in München die XX. Olympischen Sommerspiele statt, zugleich die ersten Sommer-spiele mit einer souveränen DDR-Olympiamannschaft. Mit dabei waren auch Sportlerinnen und Sportler des SC Einheit Dresden. 1954 gegründet, war der SC Einheit Dresden für die Förderung des Leistungssports im Bezirk Dresden zuständig. Spätestens mit dem vom SED-Politbüro im Hinblick auf die Spiele in München gefassten Leistungssportbeschluss von 1969 konzentrierte man sich auch hier auf die besonders medaillen-trächtigen Sportarten. 1972 gingen schließlich Dresdner Athleten in den Sportarten Rudern, Kanu, Schwimmen, Turmspringen, Gewichtheben und in der Leichtathletik an den Start.
Die abgebildete Fotomontage entstand im unmittelbaren Vorfeld der Olympischen Spiele. Zu sehen ist unter anderem der legendäre, mehrere Jahre die Weltspitze dominierende Rudervierer ohne Steuermann. In der Besetzung Frank Forberger, Frank Rühle, Dieter Grahn und Dieter Schubert errangen sie zum zweiten Mal nach 1968 die Goldmedaille. Es blieb der einzige Sieg für Dresdner Sportler in jenen Tagen. Dennoch konnten weitere Erfolge gefeiert werden: Christine Herbst schwamm mit der 4x100 Meter Lagenstaffel in Europarekordzeit zu Silber. Ebenfalls Silber gab es für die Sprinterin Evelin Kaufer, die in der 4x100 Meter Staffel als Startläuferin zum Einsatz kam. Eine Bronzemedaille erhielt Gudrun Wegner nach ihrem starken Rennen über 400 Meter Freistil, das sie in neuer DDR-Rekordzeit beendete. In dieser Aufzählung sollen die Fußballer der SG Dynamo Dresden nicht unerwähnt bleiben. Hans-Jürgen Kreische, Reinhard Häfner, Siegmar Wätzlich und Frank Ganzera, übrigens jeder ein Torschütze im Turnier, wurden mit der DDR-Nationalmannschaft, unter anderem nach einem Zwischenrundensieg gegen die Auswahl der BRD, überraschend Dritter.
Auch allen anderen Athleten, nicht nur den Medaillengewinnern, können hervorragende Leistungen attestiert werden. Absolut beeindruckend ist, dass beinahe alle Dresdner Sportler das Finale in ihrer jeweiligen Disziplin erreichten. Doch allein der Blick in die Ergebnislisten lässt nichts von den dramatischen Ereignissen erahnen, die außerhalb des Sportlichen bis heute in Erinnerung geblieben sind. Am 10. Wettkampftag nahmen palästinensische Terroristen Mitglieder des israelischen Nationalteams als Geiseln. Der anschließende Befreiungsversuch durch die bayerische Landespolizei endete in einem Desaster. Der bereits erwähnte Dieter Grahn meinte später, die Geschehnisse hätten „für einen Bruch in dem bis dahin friedlichen Fest gesorgt“. Wie alle, genoss er die zuvor tolle Stimmung, aber „plötzlich war alles abgeriegelt und so bedrückend.“ Nach einem halben Tag Unterbrechung wurden die Spiele fortgesetzt. „The Games must go on“, wie IOC-Präsident Avery Budage verkündete.
Sportlich waren es insgesamt überaus erfolgreiche Tage. Die Mannschaft der DDR belegte mit 66 Medaillen, darunter 20x Gold, 23x Silber sowie 23x Bronze, Platz drei in der Nationenwertung, hinter der UdSSR und den USA. Damals wie heute treibt jeden Athleten der Siegeswille zu Höchstleistungen an. Aktuell bereiten sich die Olympiakandidaten des Dresdner SC auf die kommenden Olympischen Spiele in Tokio vor.
Quelle: Fotomontage „Teilnehmer der Olympischen Spiele 1972. SC Einheit Dresden“, Stadtarchiv Dresden, 13.68 SC Einheit Dresden / DSC 1898 e.V., Nr. 75;
Zitat Dieter Grahn entnommen aus Maik Schwert: Ein Bruch im friedlichen Fest, Sächsische Zeitung (Ausgabe Dresden) vom 16. Juni 2004, S. 13.
Patrick Maslowski
Januar 2021

Schwimmen und Schwitzen im großen Stil. Zur Geschichte des Güntzbades in Dresden
Mit den Worten „Dem Bauherrn zur Ehr‘, der Stadt zur Zierde, den Mitbürgern zum Segen“ übergab Stadtbaurat Hans Erlwein (1872-1914) im Dezember 1905 feierlich das neu errichtete Güntzbad in die Hände der Stadtverwaltung. Nach der Eröffnung am 2. Januar 1906 verfügte die Großstadt Dresden somit endlich über ein modernes städtisches Hallenbad. Bereits 1897 soll Oberbürgermeister Otto Beutler (1853-1926) bei einem Besuch des „großen Schwimmbads“ in Stuttgart die Idee hierzu entwickelt haben. Die Initiative für die Realisierung des Projektes ergriff die gemeinnützige Dr. Güntz’sche Stiftung, die für sämtliche Baukosten aufkam und der Stadt zusätzlich einen Reservefond zur Instandhaltung zur Verfügung stellte. Die Stiftung erwarb am 1. April 1899 zunächst Grundstücke unmittelbar an der Carolabrücke in der Marschnerstraße und am Elbberg. Die beiden Straßenfronten wurden mit Wohn- und Geschäftshäusern bebaut, während die Badeanlagen im hinteren Teil der Grundstücke errichtet wurden. Für Anregungen zur baulichen Gestaltung reiste Stadtbaurat Edmund Bräter (1855-1925) sogar eigens zum Müller‘schen Volksbad nach München.
Das Güntzbad war einer der bedeutendsten Jugendstilbauten in Dresden und verfügte über ein Herren- und ein Damenbecken, ein römisch-irisches Schwitzbad, ein Hundebad sowie etwa 50 Zellen für Wannenbäder. Auch ein Erfrischungsraum, eine Wäscherei und ein Friseur waren vorhanden. Das Wasser wurde über einen eigenen Brunnen bezogen und ein Pumpwerk sorgte für einen regelmäßigen Wasseraustausch. Der Gesamtaufwand für den Bau betrug etwa 1,5 Millionen Mark. Von Anfang an entwickelte sich das Bad zum Besuchermagnet: 1906 waren bereits 195 232 Gäste zu verzeichnen, bis 1925 erhöhte sich die Zahl auf 703 228. Der Blick auf die insgesamt rund 558 000 Besucherinnen und Besucher im Jahr 2019 in allen sieben Dresdner Schwimmhallen erlaubt Vermutungen über das damalige Gedränge in den Badeabteilungen und Schwitzstuben. In der Folge verschwanden viele der etwa 50 kleineren, privaten Badeanstalten und das Güntzbad konnte den Besucherstrom nicht mehr aufnehmen. Daher wurde 1925 unter Stadtbaurat Paul Wolf (1879-1957) ein Erweiterungsbau mit Kurbadeabteilung projektiert, der im April 1927 eröffnet werden konnte. Zugleich erfolgte eine Modernisierung der älteren Bauten und der technischen Betriebsanlagen. So war das Güntzbad möglicherweise das erste deutsche Hallenbad mit Unterwasserbeleuchtung. In der Badeanstalt fanden nun 143 Personen eine Beschäftigung, darunter auch ein „Badearzt“.
Bei den Luftangriffen im Februar 1945 wurden die Gebäude zwar beschädigt, aber nicht zerstört. Die Wiederherstellung fand bis Ende der 1950er Jahre weitgehend Befürwortung, da der Bäderbedarf in Dresden hoch war und durch den teilweise sehr guten Erhaltungszustand hierfür nur „verhältnismäßig geringe finanzielle und baustoffmäßige Mittel“ notwendig waren. Trotzdem wurde die Instandsetzung immer wieder verschoben und das Güntzbad 1964 schließlich abgerissen. Damit verschwand ein Wahrzeichen der Dresdner Bade- und Stiftungskultur endgültig aus dem Herzen der Stadt.
Quelle: Stadtarchiv Dresden, 6.4.40.1, Stadtplanungsamt Bildstelle, Schlüssel II8942, Nr. 1, unbekannter Fotograf, bearbeitet.
Johannes Wendt
Archivalien des Monats aus dem Jahr 2020
Dezember 2020
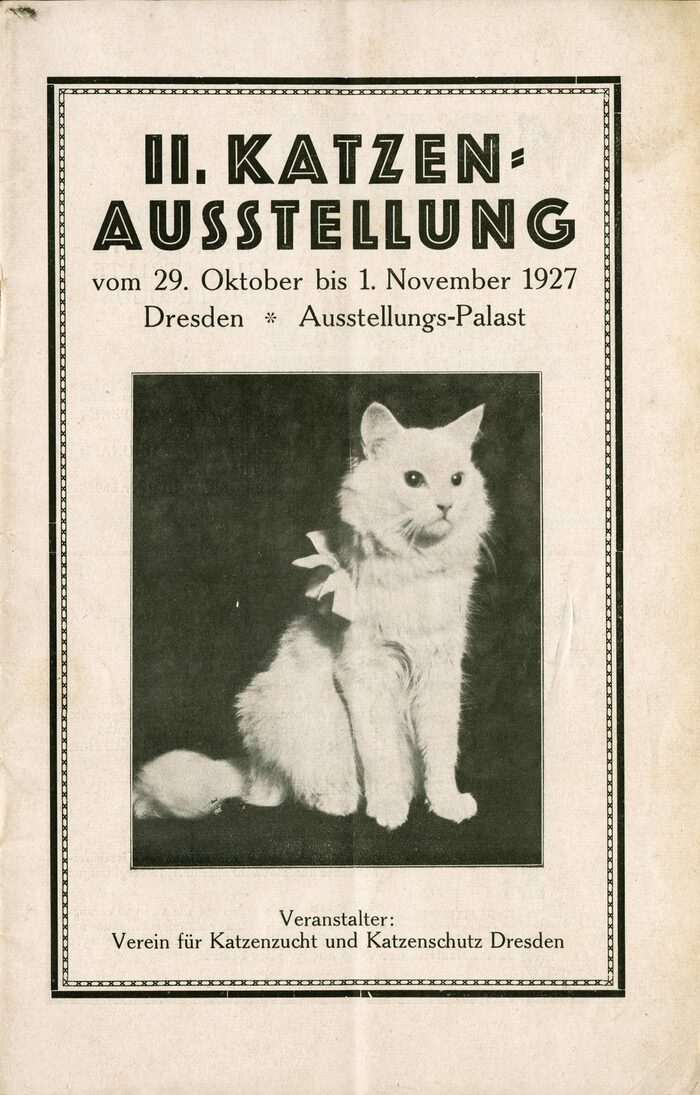
Katalog zur II. Dresdner Katzenausstellung vom 29. Oktober bis 1. November 1927. Zur Geschichte des Tierschutzes in Dresden
„Viele tausende deutsche Katzenfreunde haben sich zu einem Bunde zusammengeschlossen, der Zucht und Schutz der Katze zur Aufgabe hat.“ so berichtet der Ausstellungskatalog der II. Katzenausstellung aus dem Jahr 1927 – unser Archivale des Monats Dezember 2020.
Obwohl die Geschichte der Katzenausstellungen bis ins 16. Jahrhundert zurückreicht, wird erst seit dem Ende des 19. Jahrhunderts von Katzenschauen im heutigen Sinne gesprochen. Nach großen Ausstellungen in New York und London fand die erste deutsche Katzenausstellung im Oktober 1897 in München statt. Die erste internationale Veranstaltung wurde am 15. März 1900 in Mannheim abgehalten. Gleichzeitig bildete sich eine Vielzahl von Vereinen, wie beispielsweise der 1925 in Dresden gegründete „Bund für Katzenzucht und Katzenschutz e. V.“, kurz BKK e. V. genannt, der sich die Katzenzucht und den Katzenschutz zur Aufgabe machte. 1931 war der BKK e. V. bereits der mitgliederstärkste Zuchtverein in Deutschland. Zu den Gründungsmitgliedern gehörten neben dem Tierarzt Dr. Georg Lunze, der Zoologie-Professor Dr. Friedrich Schwangart und der Redakteur der „Tierbörse“, einer Fachzeitschrift für Kleintierzüchter, Alexander Silgradt. Die Schwerpunkte der II. Dresdner Katzenausstellung 1927 sowie der Arbeit des Vereins insgesamt lagen auf der Aufwertung der „gemeinen Hauskatze“ gegenüber ihren Artgenossen edler Abstammung. So benennt der Ausstellungskatalog 252 Katzen, die sich zum Teil aus „Aristokraten des Katzengeschlechts“ zusammensetzten, aber auch aus „guterzogene(n) und betreute(n) Hauskatzen“. Bereits in der von Silgradt 1926 herausgegebenen Publikation: Das Katzenbuch – Rassen und Zuchtziele, Lebensgewohnheiten und Charaktereigenschaften, verfasst von Wolf von Metzsch-Schilbach, wird der „missverstandene Charakter der Haus- und Hofkatzen“ thematisiert. Ähnlich wie heute, entbrannte der Disput zwischen Katzenliebhabern und -gegnern um die schrumpfende Population der Singvögel. Da insbesondere die Freigänger dem Töten der ‚geflügelten Gesangswunder‘ beschuldigt wurden, präsentierten die Macher der Katzenausstellung unter der Rubrik „Vogelstuben-Katzen und Katzen mit anderen Tieren zusammen“ einige besonders gesellige Exemplare, die in friedlicher Koexistenz mit Vögeln, Hunden, Hühnern sowie einem Eichhörnchen im Freien sowie in Wohnungen lebten. Silgradt selbst ließ sich im Ausstellungskatalog mit schwarzer Angorakatze im Arm, der eine weiße Ratte auf dem Rücken saß, ablichten.
Die aus 27 Seiten bestehende Broschüre umfasste neben dem Aufruf zur Beteiligung am Katzenschutz sowie der Aufstellung der teilnehmenden Tiere auch zahlreiche Werbeanzeigen, darunter „Spratt’s Katzenfutter“, Fress- und Trinknäpfe, der Katzenkasten „Ideal“ für eine hygienische und gutriechende Katzentoilette sowie Körbchen, Transportboxen und Bettchen. Für das körperliche Wohlergehen der Katze warben mehrere Tierärzte sowie eine Katzenapotheke. Nicht zu unterschlagen sind aber auch die Annoncen für Felle und das Ausstopfen von Tieren. Am Ende des Vorwortes zum Ausstellungskatalog wendet sich Silgradt, in seiner Position als Bundesvorsitzender des Dresdner Vereins, mit einer Mahnung an seine Leserschaft, die auch heute, insbesondere in der Vorweihnachtszeit aktuell ist und Beachtung finden soll: „So werden junge Kätzchen, ihres bestechenden Liebreizes wegen, als lebendes Spielzeug betrachtet, um später ausgesetzt zu werden und einen Leidensweg zu gehen, zu dem sie der Schöpfer wahrhaftig nicht bestimmt haben kann.“
Quelle: Stadtarchiv Dresden, 17.4.1 Drucksammlung bis 1945, Nr. 104.
Sylvia Drebinger-Pieper
November 2020
Die Gartenstadtbewegung: Städtebautrend 1908 in Dresden
Der Begriff der Gartenstadt ist untrennbar mit der Gartenstadtbewegung in England verbunden. Im Stadtarchiv Dresden gibt es eine Abhandlung "Über die englische Gartenstadtbewegung" der Deutschen Gartenstadtgesellschaft aus dem Jahr 1926. Einer der Vordenker der Gartenstadt war der Engländer Ebenezer Howard (1850 – 1928). In London geboren konnte er die Nachteile einer schnell wachsenden Großstadt für dessen Bewohner in der Zeit der Industrialisierung bezeugen. Zwar tritt die Idee der Gartenstadt schon seit 1845 in Publikationen verschiedener Autoren in Erscheinung, Howard jedoch ist es zu verdanken, dass das theoretische Konzept mit der Gartenstadt Letchworth, in der Nähe von London im Jahr 1903, in die Realität umgesetzt wurde. In seinen Büchern „Tomorrow. A Peaceful Path to Real Reform“ von 1898 und in dessen Neuauflage 1902 mit dem Titel „Garden Cities of Tomorrow“ beschreibt Howard die Grundsäulen einer Gartenstadt. Die Gründung der Deutschen Gartenstadtgesellschaft und deren Veröffentlichungen verdeutlichen das große Interesse an dem Thema auf deutscher Seite und den Austausch zwischen den beiden Nationen.
In Sachsen unterzeichnete am 31. März 1908 der Gemeindevorstand von Rähnitz einen Vertrag mit der noch zu begründenden „Gartenstadt Hellerau GmbH“ und verankerte damit einen Teil der Rahmenbedingungen für die Entstehung der Gartenstadt Hellerau auf den Fluren von Rähnitz und Klotzsche. Der Möbelfabrikant Karl Schmidt (1873 - 1948) hatte 140 Hektar Land von dort ansässigen Bauern gekauft und machte die Gartenstadtgesellschaft Hellerau mbH im weiteren Verlauf des Jahres 1908 zur Grundeigentümerin der neuen Gartenstadt. Schmidt plante zu der Zeit die Erweiterung seines immer erfolgreicheren Unternehmens „Deutsche Werkstätten für Handwerkskunst Karl Schmidt“. Es sollte jedoch nicht nur bei einem Fabrikneubau bleiben. Vielmehr wurde die Betriebserweiterung dafür genutzt eine planmäßig angelegte Siedlung aufzubauen. Geprägt von dem Geiste der Lebensreformbewegung des 19. Jahrhunderts, sollte diese weit mehr als nur eine Werkssiedlung für die eigenen Arbeiter sein. Der Anspruch der Gartenstadt war es, durch die architektonisch-künstlerische Gestaltung die sozialen Bedürfnisse der Bewohner zu beachten. Das aktuelle Archivale des Monats zeigt eine Werbepostkarte der Baugenossenschaft Hellerau mit dem Beispiel einer Mietvilla im großzügigerem Stil. Gleichzeitig bot die Genossenschaft Mitobjekte im Kleinwohnungsbau an, die trotzdem die Vorzüge und Lebensqualität einer Gartenstadt ermöglichten.
Für die Flurstücke der Gartenstadt gab es einen besonderen Bebauungsplan, der auch für die Gemeinde Rähnitz verpflichtend war. Dieser Gesamtbebauungsplan stammte von Richard Riemerschmid (1868 – 1957), Architekt aus München, und bildete die Grundlage für die spezielle städtebauliche Ausrichtung der Gartenstadt. Zusätzlich wurde die besondere künstlerische Bebauung der Gartenstadt durch die Schaffung einer Bau- und Kunstkommission abgesichert. Dieses gewählte Gremium genehmigte, neben den amtlichen Verfahren, alle Bauten in der Gartenstadt Hellerau. Der Vertrag nennt die Bau- und Kunstkommission und schreibt der Gemeinde Rähnitz vor „in die innere Entwicklung der Gartenstadt Hellerau tunlichst nicht einzugreifen und insbesondere den von dieser Kunstkommission gebilligten Bauten, …, nicht entgegenzutreten.“.
Bis 1913 wurden 31 Gartenstädte gegründet, aber Hellerau wird bis heute als Deutschlands erste Gartenstadt gefeiert, vor allem, weil die Howardschen Vorgaben von genossenschaftlichem Wohnungsbau und dem Ausschluss von Bodenspekulationen durch Wohlfahrtsland, hier im hohen Maße realisiert wurden.
Quelle: Stadtarchiv Dresden, 17.4.1, Drucksammlung bis 1945, 24-25.
Ann-Marie Rajda
Oktober 2020

Ein „herausragendes städtisches Projekt der Weimarer Republik“. Das Sachsenbad in Dresden-Pieschen
Das vom Stadtbaurat Paul Wolf (1879–1957) entworfene Volksbad Dresden Neustadt Nord-West in Pieschen, seit den 1930er-Jahren auch als Sachsenbad bezeichnet, entstand in den Jahren 1927 bis 1929 und gehört neben dem Bau des Deutschen Hygienemuseums zu den bedeutenden noch existierenden Großbauten der Klassischen Moderne in Dresden.
Der Bau entstand zusammen mit der angrenzenden Volksbibliothek, mit der er durch einen überdachten Gang verbunden ist und einen rechteckigen Platz mit Wasserbecken umschließt. Er ist Teil eines größeren stadtplanerischen Zusammenhanges. Das Bauensemble bildete den Auftakt zu den sich anschließenden Sportanlagen sowie zu einem Grünzug mit Schrebergärten. Der Idee eines Forums folgend, bildete die Anlage den baulichen wie ideellen Mittelpunkt eines teilweise neu entstehenden Wohnviertels, zu dem unter anderem eine modern-dynamische Wohnsiedlung von Hans Richter (1882–1971), dem wichtigsten Dresdner Architekten des Neuen Bauens, gehört. Das Ensemble wurde, so die Argumentation der Denkmalschutzbehörde, „als herausragendes städtisches Projekt der Weimarer Republik, das Funktionen, wie Bildung, Sport und Wohnen miteinander verband“ unter Schutz gestellt.
Die vielfältigen Funktionen (Schwimm-, Wannen- und Brausebad, Kurabteilung, Gymnastiksaal, Erfrischungsraum, Friseur, Bibliothek) dieses einstigen Stadtteilzentrums wurden im Laufe seines 65jährigen Betriebes rege genutzt, zeitweise von über 300.000 Besuchern im Jahr. Daraus ergibt sich neben seinem architektur- und kulturgeschichtlichen Wert eine hohe orts- und sozialgeschichtliche Bedeutung für die umliegenden Stadtviertel. Zugleich verbindet sich mit dem Bau ein Identifikationspotenzial, welches seit seiner Schließung im Jahr 1994 auch gegenwärtig ungebrochen stark erscheint und sich seit 2006 auch in Form einer starken Bürgerinitiative, Petitionen und anderen Aktionen äußert.
Dresden hat neben Hellerau und dem Hygienemuseum bezüglich der Reformbewegungen der klassischen Moderne ein vielfältiges materielles und immaterielles Kulturerbe aufzuweisen, welches derzeit erst schrittweise wiederentdeckt und in seiner Bedeutung neu erkannt wird. Dessen wissenschaftliche, kulturelle und auch touristische Erschließung dürfte für die Stadt Dresden auch zukunftsperspektivisch von besonderem Wert sein.
Quelle: Stadtarchiv Dresden, 6.4.40.1 Stadtplanungsamt Bildstelle, Nr. II7602, II7248, II7241, unbekannter Fotograf, 1929–1934.
Stefan Dornheim
September 2020
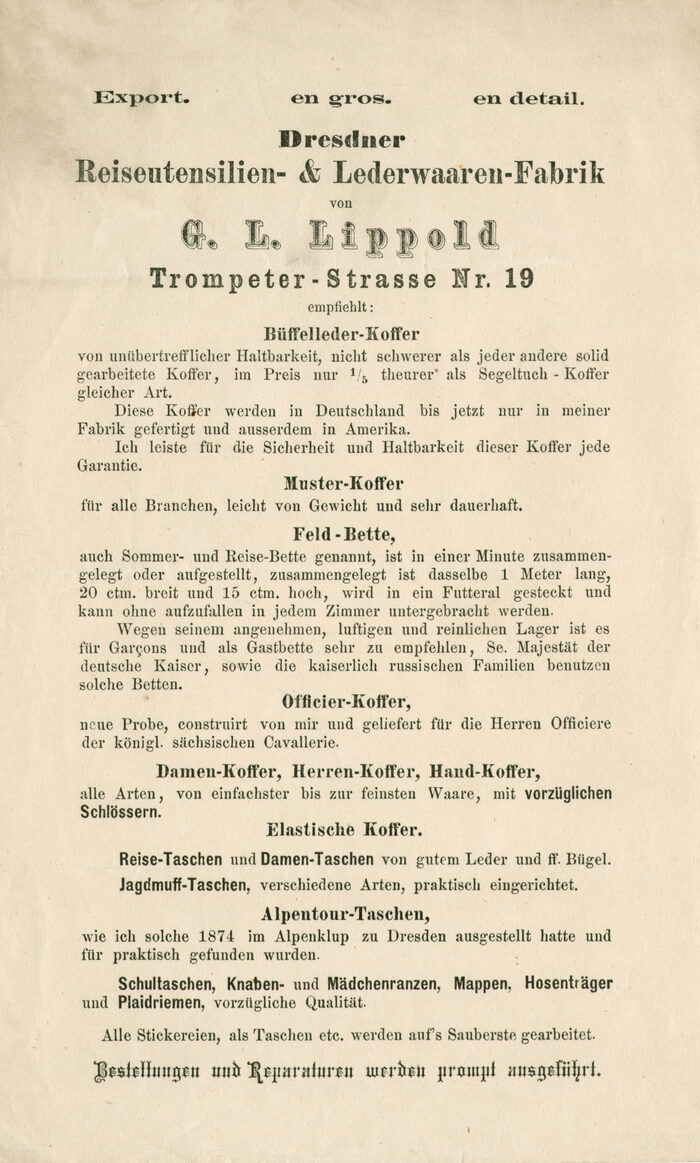
„Ich leiste für die Sicherheit und Haltbarkeit dieser Koffer jede Garantie.“ Die Dresdner Reiseutensilien- & Lederwaaren-Fabrik G. L. Lippold
Am Ende des 19. Jahrhunderts führten der wirtschaftliche Aufschwung und die moderne Entwicklung des Verkehrswesens zu einem gesteigerten Reisebedürfnis in der Bevölkerung, in dessen Folge sich ein Massenmarkt für Reisegepäck etablierte, allen voran in der Kofferproduktion. Allein in Dresden gab es um die Wende zum 20. Jahrhundert zehn Kofferfabriken. Eine davon war die 1863 gegründete „Dresdner Reiseutensilien- und Lederwaarenfabrik G. L. Lippold“, die sich aufgrund der außerordentlichen Qualität ihrer Produkte über Dresden hinaus einen Namen machte. Der Begründer und Inhaber, Gottfried Luithard Lippold (1836-1904), war ein gelernter Täschner und Tapezierer aus dem Vogtland, dessen Erfolgsprinzip auf der Verwendung hochwertiger Materialien und innovativer Herstellungsprozesse gründete. Im Februar 1863 beantragte er das Dresdner Bürgerrecht sowie das Gewerberecht für ein Täschnerei- und Tapezierereigewerbe. Dank der rastlosen Tätigkeit und der hervorragenden Fachkenntnisse Lippolds florierte das Geschäft. Wie aus der historischen Geschäftsempfehlung, unserem Archivale des Monats September, ersichtlich ist, wurden in der Fabrik zunächst Reise- und Musterkoffer gefertigt sowie Taschen aller Art und Militärausrüstungsgegenstände. Später nahm G. L. Lippold auch die Produktion der truhenartig gestalteten Rohrplattenkoffer auf. Dieses Koffermodell erfreute sich bei den Reisenden wegen seiner Leichtigkeit und Widerstandsfähigkeit – trotz des erhöhten Preises – großer Beliebtheit. Im Jahr 1880 meldete Lippold die aus Javarohr gefertigten Koffer zum Patent an. Die eingetragene Schutzmarke, die im Briefkopf des abgebildeten Schreibens zu sehen ist, betont auf kreative Weise noch einmal die Leichtigkeit der Koffer – der Storch im Zentrum des dreieckigen Metallblättchens bringt kein Neugeborenes, sondern einen Lippold‘schen Rohrplattenkoffer.
Wie aus der im Stadtarchiv aufbewahrten Bürger- und Gewerbeakte für Herrn Lippold hervorgeht, reichte der ursprüngliche Fertigungsort auf dem Grundstück Trompeterstraße 19 bald nicht mehr aus, so dass weitere Werkstätten in der Stephanienstraße 49, in der Blasewitzer Straße 45 und in der Trinitatisstraße 36 eingerichtet wurden. Im Kellergeschoss befanden sich Rohrhandpressen und eine „Fraismaschine“ für das Zerlegen des Rohrs und das Pressen der Platten. In den oberen Etagen waren die Arbeiter mit Beziehen, Streichen, Schablonieren, Lackieren, Leimen und Trocknen beschäftigt. Der „durch das Leimen und Beziehen der Rohrplatten entstehende nach der Straße abziehende widerwärtige Geruch“ führte zu Beschwerden aus der Nachbarschaft, weshalb der für die Überprüfung verantwortliche Bezirksinspektor festlegte, dass die straßenseitigen Fenster stets geschlossen zu halten seien. Die Ausstattung der Werk- und Arbeitsräume entsprachen den damaligen neuesten Standards. Die Räume waren hell, geräumig und gut ventiliert und mit Dampfheizung und Gasbeleuchtung ausgestattet. Neben einem Essraum standen den mehr als 100 männlichen Arbeitern im Alter von über 16 Jahren sanitäre Anlagen zur Verfügung. Auch auf Maßnahmen zum Arbeitsschutz wurde Wert gelegt.
Auch wenn die Dresdner Reiseutensilien-Fabrik G. L. Lippold 1931 in Folge der Weltwirtschaftskrise erlosch, können Liebhaber bis heute Exemplare der Lippold‘schen Rohrplattenkoffer im Antiquitätenhandel erwerben. Zeitlos ist auch der Verweis auf die Fabrik in der Weltliteratur Erich Kästners. Wie im vierten Kapitel seiner Autobiographie „Als ich ein kleiner Junge war“ nachzulesen ist, ging sein Vater jeden Morgen in die Trinitatisstraße, um in der „Kofferfabrik Lippold“ den Lebensunterhalt für die Familie zu verdienen.
Quelle: Stadtarchiv Dresden, Bestand 17.4.1 Drucksammlung bis 1945, Sign. 277, Geschäftsempfehlungen „L“.
Claudia Richert
August 2020
Das verschollene Kruzifix. Werden und Vergehen eines Wahrzeichens
Die Hochflut der Elbe im Jahr 1845 war eine der bedeutsamsten Naturkatastrophen in der sächsischen Geschichte. In der damals einzigen städtischen Elbüberquerung, der heutigen Augustusbrücke, fand der aufgewühlte Strom einen besonders unliebsamen Widersacher. Auf dem Höhepunkt des Hochwassers am 31. März 1845 riss die Elbe einen Teil des fünften Brückenpfeilers mitsamt dem darauf befindlichen Wahrzeichen in die Tiefe. Dabei handelte es sich um ein vergoldetes Kruzifix, das auf einem mit Inschriftentafel versehenen Felsenpostament aus Pirnaer Sandstein über der Elbe thronte und insgesamt etwa acht Meter hoch gewesen sein soll. Das Monument war ein beliebter Ort der Andacht und des Gebets für fromme Christen und galt als Symbol für die „historisch begründete Verbindung der Brücke mit dem Heiligen Kreuz“ in Dresden.
Der bekannte Glockengießer Andreas Herold (1623–1696) goss das Kruzifix aus Metall, das bereits 1670 unter Kurfürst Johann Georg II. (1613–1680) aufgestellt wurde. Aber schon im 16. Jahrhundert hatten ältere Kruzifixe die Brücke geziert. Bei den Brückenarbeiten unter August dem Starken (1670–1733) wurde das jüngste Modell im Jahr 1731 versetzt und durch den massiven Unterbau aus Sandstein nach Entwürfen von Zacharias Longuelune (1669–1748) ergänzt. Als unterer Abschluss des Kruzifixes wurde eine vergoldete Weltkugel mit Schlange gesetzt. Vor der Sprengung der Brücke im Jahr 1813 durch die französische Armee konnte das Monument noch entfernt werden und blieb somit unversehrt. Den unnachgiebigen Kräften des Elbstroms vermochte es jedoch nicht zu entkommen: am Vormittag des 31. März 1845 zeichnete sich ein Riss im sogenannten „Kreuzpfeiler“ ab, bevor dessen Hinterhaupt und Zierde „mit lautem Getöse" in die Fluten stürzte. In den folgenden Jahren ergaben sich jedoch keine Kapazitäten, die Wiederherstellung des Wahrzeichens voranzutreiben, da zunächst die Behebung der schweren Flutschäden höchste Priorität hatte.
Die Reparatur der Brücke wurde zwar umgehend in die Wege geleitet, allerdings konzentrierten sich die Arbeiten auf die schnelle und zugleich langfristige Sicherung des infrastrukturell höchst bedeutsamen Bauwerkes. Ab den 1850er Jahren erregte die Frage nach der Wiederherstellung des Kruzifixes zunehmend das öffentliche Interesse. Insbesondere gab es mehrfach private Initiativen, das Kruzifix zu bergen und wieder aufzustellen, damit „das lebendige Andenken an diese christliche monumentale Zierde“ nicht verloren ginge. Bei den Erörterungen im Stadtrat wurde dann zwar auch eine Prüfung der Wiederherstellung beschlossen, allerdings verlief das Projekt im Sand. Ein wesentlicher Grund hierfür war, dass bereits bei der umgehend eingeleiteten Reparatur die erneute Aufnahme eines derart ausladenden Bauwerks wegen der statischen Problematik nicht berücksichtigt wurde. Obwohl in den ersten Jahren nach dem Unglück sogar ein „Taucherapparat“ für die Auffindung verwendet worden sein soll und auch später zahlreiche Nachforschungen erfolgten, blieb das Kruzifix bis heute verschollen.
Quelle: Pescheck, C. J. L.: Der Einsturz des Kreuzpfeilers beim Hochwassers 1845, Dresden, um 1845, bearbeitet.
Johannes Wendt
Juli 2020

Schneller und bequemer über die Elbe. Die Einweihung der Carolabrücke vor 125 Jahren
Im Juli vor 125 Jahren gab es in Dresden ein Großereignis. Nach fast drei Jahren Bauzeit konnte am 6. Juli 1895 die Königin-Carola-Brücke eingeweiht werden. Benannt wurde sie nach Carola von Wasa-Holstein-Gottorp, der sächsischen Königin und Ehefrau von König Albert. Die Einweihung fand im Beisein der königlichen Familie statt. Zudem hatte die Stadt, in Person des Oberbürgermeisters Beutler, viele Honoratioren zum Festakt eingeladen. Die Carolabrücke war mit Fahnen und Laubgewinden geschmückt und auf der Altstädter Seite standen die beteiligten Gewerke in ihrer Tracht und mit ihren Abzeichen aufgereiht. Um 10 Uhr „kündeten lebhafte Hochrufe von seiten des zahlreichen Publikums das Nahen der königlichen Majestäten an.“ Oberbürgermeister Beutler begrüßte das Königspaar und begleitete sie zu ihren Plätzen in den tempelförmigen Schmuckbau, der mit blau gelben Tüchern geschmückt war.
Der Stadtbaurat Herrmann Klette leitete den Bau der Brücke, mit dem man dem zunehmenden Verkehrsaufkommen der Großstadt Rechnung trug. In der Mitte fuhren zweigleisig die Straßenbahnen. Für den Güterverkehr waren links und rechts der Schienen die Fahrwege für die Fuhrwerke sowie anschließend Gehwege angelegt. Für die Überquerung der Carolabrücke wurde ein Brückenzoll erhoben, so wie es auch schon bei der Augustus- und Albertbrücke üblich war. Personenwagen bezahlten 10 Pfennige je Zugtier. Ebenso mussten 10 Pfennige für beladene und unbeladene Fuhrwerke je Zugtier bezahlt werden. Eine Ausnahme bildeten Hundefuhrwerke. Da reduzierte sich der Brückenzoll um die Hälfte auf 5 Pfennige. Vom Brückenzoll ausgeschlossen waren alle Hofequipagen, kaiserliche, königliche und städtische Beamte, Militär und Feuerwehr sowie Leichenwagen. Nach Ende der Einweihungsfeierlichkeiten wurde die Brücke dem öffentlichen Verkehr übergeben.
Bis zum 7. Mai 1945 verband die Carolabrücke die Altstädter und Neustädter Seite. Einen Tag vor Kriegsende wurde sie, vor der anrückenden Roten Armee, gesprengt. Die Beschädigungen waren so groß, dass man sich nach Kriegsende entschied, die Brücke stückweise abzureißen. Erst 1967 begannen die Arbeiten für eine neue Elbquerung an alter Stelle. Die neue Brücke trug den Namen des ehemaligen sächsischen Ministerpräsidenten und Dresdner Oberbürgermeister, Dr. Rudolf-Friedrichs. 1991 erhielt sie ihren ursprünglichen Namen zurück.
Quelle: Stadtarchiv Dresden, 2.1.1 Ratsarchiv, A.XXIV.90.
Marco Iwanzeck
Juni 2020
Zur Historie der Badekultur an der Prießnitz. Erquickende Heilkraft und „anstößigste Schauspiele“?
Erstmals im Jahr 1810 beantragte der Amtsrichter Carl Gottlieb Hartzsch (1757-1811) eine Konzession für die Anlegung eines Flussbades in der Prießnitz. Nach dessen Beschreibung waren zu dieser Zeit täglich „mehrere hundert Menschen“ in dem Flüsschen baden. Zahlreiche Wohlhabende hätten sogar wegen der medizinisch erprobten Heilkraft des Wassers ihre Sommerwohnung in der Nähe gewählt. Bei dem Andrang auf das Badeparadies ergaben sich allerdings Bedenken, da das Baden an den nur wenigen tiefen Stellen besonders begehrt war und hier wegen der fehlenden Geschlechtertrennung „die größte Schaamlosigkeit“ herrschen würde. Spazierende wären so dem „anstößigsten Schauspiel“ ausgesetzt und „anständige“ Badewillige am heilsamen Baden gehindert. Gesundheitliche und soziale Benachteiligungen sollten demnach mit der Einrichtung eines ordnungsgemäßen Badebetriebes beseitigt werden. Der Antrag wurde aber zunächst mit Verweis auf mögliche Schäden an den kostbaren königlichen Holzplantagen im Prießnitzgrund durch den Besucherverkehr abgelehnt.
Die Konzession für die Anlegung eines Bades mit Separierung der Geschlechter und adäquatem Sichtschutz erlangte dann erst der Kaufmann Carl August Rehbock (1802-1848) im Jahr 1835, sodass die „vorzügliche Heilkraft“ auch denjenigen zugänglich gemacht werden konnte, „in denen noch nicht der letzte Funken von Tugend und Gefühl für Sittlichkeit erloschen“ wäre. Anfangs störten die Vergnüglichkeiten in der Badeanstalt unweit des Alaunplatzes nur die lautstarken Übungen der Tamboure auf dem Exerziergelände. Eine zugehörige Restauration versorgte die Gäste sogar mit „Butterbrod“, Bier und Wein. Nach einer chemischen Untersuchung im Jahr 1838 konstatierte der renommierte Arzt und Apotheker Dr. Friedrich Adolph August Struve (1781-1840) eine exquisite Reinheit des Prießnitzer Wassers und verglich dessen Qualität sogar mit Heilquellen in Leuk und Pfäfers in der Schweiz. Auch dem feinen Sand wurde eine besondere Heilwirkung beigemessen: „Sandbaden“ hatte damals Konjunktur und konnte an der Prießnitz mit ihren sandigen Böden ausgiebig gepflegt werden.
1839 übernahm der Arzt Dr. Friedrich Wilhelm Ruschpler (1789 - 1861) das Prießnitzbad mitsamt Schank- und Speisewirtschaft, der im Übrigen zuvor auch das erste Dampfbad in Dresden eröffnet hatte. Aufgrund der befürchteten sittlichen Verführungen wurden sonstige Badeplätze für die jeweiligen Geschlechter restriktiv festgelegt und streng kontrolliert: bei Zuwiderhandlungen war mit „ernsthafter Zurechtweisung und nach Befinden gesetzlicher Bestrafung“ zu rechnen. Trotzdem erfolgte schon 1872 die Schließung des Badeplatzes für Frauen wegen vermeintlichen „Unzuträglichkeiten“. Letztlich verschwanden aber vor allem mit der fortschreitenden Bebauung entlang des Prießnitzlaufes sukzessive die offiziellen kostenfreien Badeplätze, obwohl diese insbesondere für die zahlreichen ärmeren Kinder aus der Antonstadt auch stets eine wichtige hygienische Funktion erfüllt hatten. Eine Verschiebung der Freiräume war kaum möglich, da die Heide als Staatsforst dem Zugriff der Stadt entzogen war. Die Prießnitzmündung blieb hingegen als Refugium der Badekultur an der Prießnitz für Kinder erhalten.
Quelle: Stadtarchiv Dresden, 6.4.40.2, Stadtplanungsamt Bildstelle, Nr. XV664, unbekannter Fotograf.
Johannes Wendt
Mai 2020
„Appetitlich frisch – für den Gästetisch“ eine Menüempfehlung von Rudolf Hoppe. Ein Meilenstein Dresdner Gastronomiegeschichte residiert im Stadtarchiv Dresden
Kennen Sie noch den „Hoppe-Keller“ oder „Neustädter-Keller“ im Bahnhof Dresden-Neustadt? In der Zeit von 1936 bis 1945 wurde dieser von Rudolf Hoppe geleitet. Ein Teil seiner persönlichen Sammlung konnte durch das Stadtarchiv übernommen werden und ergänzt die Bestände zur Gastronomie um bedeutende Unterlagen. In der Sammlung befinden sich neben persönlichen Unterlagen und Erinnerungsstücken aus dem 1. Weltkrieg auch zahlreiche Speisekarten des ehemaligen „Hoppe Restaurants“ im Bahnhof Neustadt. Die Speisekarten geben nicht nur Auskunft über das Angebot von Speisen und Getränke, sondern spiegeln in Bild- und Textgestaltung die politische Lage der jeweiligen Zeit. So zeigt die Sammlung Rudolf Hoppe die Entwicklung der Dresdner Gastronomie während der beiden Weltkriege bis in die 1970er Jahre hinein.
Rudolf Hoppe wurde am 29. September 1894 geboren und entschied sich nach dem Vorbild seiner Eltern für eine Ausbildung im Gastgewerbe. 1913 schloss er seine Gesellenprüfung als Koch ab und begab sich für Praxiserfahrungen nach Stockholm, Rom und Paris. Mit dem Ausbruch des 1. Weltkrieges kehrte er nach Dresden zurück und trat in den Militärdienst ein. Ab 1920 beteiligte er sich am Geschäft seiner Eltern, die das Restaurant im Bahnhof Dresden-Neustadt, den sogenannten Hoppe-Keller, unterhielten. Als 1936 sein Vater starb, übernahm Hoppe die alleinige Führung des Gasthauses.
Hoppe zeichnete sich durch kreatives Handeln und ideenreiches Marketing aus. Das brachte dem „Hoppe-Keller“ viel Aufmerksamkeit und Erfolg einbrachte. Der Gastronom entwickelte für sich eine eigene Philosophie, bei der die Zuwendung gegenüber dem Gast an erster Stelle stand. So machte er sich seine im Ausland gewonnenen Erfahrungen zu Nutze und schuf illustre zum Teil mehrsprachige Speisekarten, die nicht nur das Angebot, sondern auch Sprüche zur Unterhaltung und Werbung für sein Restaurant enthielten. In diesem Kontext entstand auch unser Archivale des Monats April der „Leitfaden für HOPPE Gäste“. Dabei handelt es sich um die Menükarte der Bahnhofsgaststätte, liebevoll als „Magen-Fahrplan“ deklariert, für Pfingsten 1943. Während die eine Seite die Auswahl an Speisen auflistet, darunter Gulasch mit Leipziger Allerlei, Kalbs- und Schweinebraten sowie ein vitaminreicher Gemüseteller mit Kartoffeln „Fleischlos und doch so gut“ genannt, befand sich auf der Rückseite der erwähnte „Leitfaden“. Auf humoristische Weise wurde der Gast mit seinen Aufgaben im Rahmen seines Aufenthaltes im Restaurant konfrontiert. Dazu gehörten neben dem Bereithalten der Lebensmittelkarten, die, „Gefühlskontrolle“ bei längerer Wartezeit sowie das pünktliche Verlassen des Restaurants bei Ladenschluss „Letzte Strassenbahn“ genannt.
Nach Kriegsende wurde ihm die Weiterführung seines Restaurants untersagt. Für Hoppe waren die Jahre nach 1949 eine durchwachsene Zeit, in von finanziellen und persönlichen Krisen geprägt war. Dennoch bewahrte sich der Gastronom sein optimistisches Auftreten, sein Engagement sowie seine Zielstrebigkeit und war im Alter von 71 Jahren sogar wieder Restaurantleiter des HO-Gaststättenbetriebes Dresden.
Quelle: Stadtarchiv Dresden, 17.2.88 Gastronomische Sammlung
Meike Dietrich
April 2020
Stadtplanung mal anders. Ein Vorschlag zum Wiederaufbau Dresdens
Schon einen Monat nach Kriegsende, im Juni 1945, arbeitete die Stadtverwaltung daran, den Wiederaufbau der Stadt zu planen und zu organisieren. Dafür wurden im Stadtgebiet Plakate für die Bevölkerung ausgehangen, die insbesondere Architekten und Bauplaner ansprechen sollten, um Ideen und Konzepte für den Wiederaufbau an die Stadtverwaltung zu senden. Der Aufruf zur Beteiligung erfuhr ein sehr großes Echo und viele Vorschläge und Skizzen wurden eingesandt.
Einen besonderen Vorschlag zur Gestaltung der Innenstadt liefert der Grafiker und Werbefachmann Fritz Müller. Nach eigenen Worten stellte seine Stadtplanung „eine kühne Lösung dar, aber wenn diese in der Durchführung von einem genialen Bauwillen, technischen Können und restloser Hingabe der Mitschaffenden getragen werde, so dürfte ein neues, der Stadt würdiges Neubild entstehen.“ Die Genialität seiner Idee bestand darin, die zerstörte Innenstadt „als warnendes Menetekel“ im Zustand vom Juni 1945 zu belassen und nur die Hauptverbindungsachsen Nord-Süd und West-Ost als Geschäftsstraßen zu erneuern. Müller meinte, dass man für die Verkehrsführung das historische Georgentor entsprechend erweitert oder verbreitert. Die zum großen Teil zerstörte Innenstadt wollte Müller mit einem großen begehbaren Wall, als breiten bepflanzten Wandelgang, umgeben, der in einer späteren Ausbaustufe mit „kleinen Bastionen, Ausstellungsgebäuden, Trinkhallen, Gaststätten geschmückt werden“ kann. Die starken Außenmauern dieses Stadtwalls sollten aus den Quadern und Steinen der vorhandenen Schuttmassen entstehen und sich „als abschließender Kranz dem Barock-charakter der alten Innenstadt anpassen.“ Die Ausmaße des Walls betrugen bei einer Länge von sieben Kilometern, zwanzig Meter Breite und zwölf Meter Höhe.
Die Innenstadt war nur noch über vier Straßenunterführungen der Hauptverkehrsachsen erreichbar. Vor dem Wall sollte eine breite Ringstraße angelegt werden, die den vorhandenen Straßen angepasst und als zentrale Geschäftsstraße gedacht wurde. Müller plante für den Bereich der Altstadt ein riesiges Mahnmal gegen Krieg und Zerstörung in Form der stehengebliebenen Ruinen.
Quelle: Stadtarchiv Dresden, 4.1.9 Dezernat Aufbau, Nr. 9, Bl. 20.
Marco Iwanzeck
März 2020

„So er wil haben frembd getrenck an weyn und bier..“ Eindrücke vom Ratskellerbetrieb vor 400 Jahren
Anfang des 15. Jahrhunderts wurde der älteste Dresdner Ratskeller im Rathaus auf dem Altmarkt erstmals in Baurechnungen erwähnt. Zwischen 1460 und 1569 war es allein das Privileg des Dresdner Rates, „frembde“ Weine und Biere auszuschenken. Der Verkauf in den Ratskellern entwickelte sich dadurch bis in die zweite Hälfte des 16. Jahrhundert zu einer außerordentlichen städtischen Einnahmequelle, zumal das einheimische Bier damals keinen besonders guten Ruf hatte. 1550 waren die Einnahmen sogar fast so hoch wie die direk-ten Steuern und machten rund ein Viertel der gesamten Einnahmen aus. Das fremde Bier stammte vor-nehmlich aus Freiberg, aber auch aus Torgau, Belgern, Kamenz, Naumburg, Ortrand und Zerbst. Zunächst hatte der Schenke, später ein eigens verpflichteter Bier- und Ohmherr oder Kellermeister zu gewährleisten, dass nur „wol schmeckende und unthadelhafftigk“ Weine und Biere bezogen wurden. Der Verkauf von Nei-gen oder „schal und vertorbenen“ Getränken war dem Schankwirt ausdrücklich untersagt. Preislich war das importierte Bier etwa doppelt so teuer wie das einheimische, insofern stammte auch das Publikum im 16. Jahrhundert eher aus wohlhabenderen Kreisen und war überschaubar: im Jahr 1505 standen gerade einmal 27 Zinnkännchen als Trink- und Schankgefäße zur Verfügung. Mit der Eingemeindung der heutigen Dresdner Neustadt 1549 und der Anlegung eines Kellers im Gewandhaus auf dem Neumarkt 1592 bereicherten zwei weitere städtische Bier- und Weinkeller den Schankbetrieb.
Nach der Kellerordnung vom 1. April 1619 hatten sich alle Gäste zu richten, die sich in den Ratskellern „eines Truncks erhohlen“ wollten. Fluchen, Schelten, Gotteslästerung und Schmähen „frommer ehrlicher Leuthe“ wurden hiernach mit Geld- und Gefängnisstrafen geahndet, die Beleidigung der „lieben Obrigkeit“ sogar mit Leib- und Todesstrafen. Auch für Handgreiflichkeiten, etwa indem „einer dem andern Maulschellen“ gab, waren Geldstrafen vorgesehen. Kamen dabei aber „Tolche oder Brod-Messer“ zum Einsatz, wurde hierfür die „frevelnde“ Hand, mit der die Klinge gezogen wurde, abgehauen. Diese martialische Ahndung war seit 1564 auch durch ein Gemälde, bestehend aus einer Komposition von Stock, Hand und Beil, in der Trinkstube des Kellers auf dem Altmarkt präsent. Ansonsten waren etwa Karten- und Würfelspiele ausdrücklich zuge-lassen, insofern sie friedlich und ohne Betrügereien verliefen. „Viehisches Schreyen und Jauchtzen“ waren hingegen verboten, ebenso „das liebe Geträncke“ vorsätzlich zu verschütten oder Tische und Bänke mit Namen, Reimen oder gar „unnützen unverschämten Gemäldten“ zu verunstalten. Nach einer Feuersbrunst im Jahr 1653, die sich durch Unachtsamkeit beim Rauchen im Neumarktskeller entwickelt hatte, wurde auch das damals so bezeichnete „Taback-Trincken“ in den Ratskellern ausdrücklich untersagt. Im Übrigen wurden diejenigen, die sich etwa aus mangelnder Einsicht an der Kellerordnung vergriffen, mit vier Wochen Gefäng-nis bei Wasser und Brot bestraft. Da war gutes Benehmen bei einem „wol schmeckenden frembden“ Bier im Ratskeller durchaus die bessere Alternative.
Quelle: Abbildung nach Emil Rieck (1852-1939), in: Baensch, W. (Hg.): Erinnerungen an den Ratskeller. Deutsche Städte-Ausstellung, Dresden 1903 (Ausschnitt, retuschiert).
Johannes Wendt
Februar 2020
"Geheimnisse unter der Maske" - Fasching 1906. Vom Tanz- und Maskenball im Dresdner Geselligkeitsverein "Harmonie"
Werden die kalten dunklen Wintermonate mit Tristesse und Schwermütigkeit in Verbindung gebracht, so galt die Ballsaison in den vorangegangenen Jahrhunderten als probates Mittel zur vergnügsamen Geselligkeit. Die Ballsaison startete am 11. November eines jeden Jahres und erlebte in den Monaten Januar und Februar ihren Höhepunkt. Den krönenden Abschluss bildeten die Faschingsveranstaltungen mit aufwendigen Maskenbällen. Wie eine solch illustre Veranstaltung ausgesehen haben kann, verrät unser Archivale des Monats. Dabei handelt es sich um eine spielerisch und farbenfroh gestaltete Festordnung der Gesellschaft Harmonie aus dem Bestand Drucksammlung mit dem Titel: „Harmonie Dresden - Maskenfest am 27. Febr. 1906“.
Ballvergnügungen waren um diese Zeit keineswegs mehr der adligen Gesellschaftsformation vorbehalten. Bereits ab der Mitte des 18. Jahrhunderts hatten sich im Zuge bürgerlicher Angleichungsprozesse in Dresden Geselligkeitsvereine gegründet. Der Verein „Harmonie“ wurde 1786 als Lesegesellschaft gegründet. Der Zweck der Verbindung bestand in „Erholung im geselligen Umgange“ und vor allem “unschuldiges und erlaubtes Vergnügen zu genießen und auf mehrere und gute Menschen zu verbreiten“. Den Mitgliedern der Harmonie stand neben dem Garten mit Kegel- und Schießplatz weiterhin ein Klub-, Spiel- und Lesezimmer in ihrem Gesellschaftshaus zur Verfügung. In den Gesellschafträumen wurde für Weinausschank und Gastronomie gesorgt. Neben Konzerten fanden auch Theateraufführungen, Liederabende und Ausflüge statt.
Besonderer Beliebtheit erfreuten sich aber die Feste und Bälle, die vornehmlich samstags, sonntags und montags veranstaltet wurden. Voraussetzung zur Teilnahme war neben der Mitgliedschaft in der Harmonie eine „salonfähige Kleidung“ entsprechend der Kleidungs- und Ballordnung. Das Maskenfest der Harmonie am 27. Februar 1906 begann um 19.30 Uhr mit dem ersten Programmpunkt „Geheimnisse unter der Maske“. In dieser Zeit traten geladene Gäste wie eine spanische Tänzerin oder ein Pariser Pantomimen-Quartett auf. Um 22 Uhr erfolgte der Aufruf zur Polonaise und zur anschließenden Demaskierung der Teilnehmer. Abschließend führten ausgewählte Mitglieder der Harmonie ein Theaterstück auf, dessen Text als Begleitheft den Besuchern zur Verfügung gestellt wurde. Auf einem Thronsessel auf dem Podium saß die in „olympischen Höhen residierende Harmonie“, die einer dringlichen Einladung des Vorstandes zur Teilnahme am Maskenfest gefolgt war. Die Rolle der Harmonie übernahm Fräulein Opitz. Nach dem Gruppentanz kam Prinz Karneval, in Person von Herrn Dr. Schaffrath, mit seinem Auto in den Festsaal gerast, um die Harmonie zu ehelichen. Die Harmonie wies ihn wegen seines ungestümen Werbens ab. Damit den lebensfrohen Prinzen Karneval nicht die Traurigkeit übermannte, vermählte die Harmonie ihn mit der reichen Industria. So nahm die Theateraufführung beim Maskenball das Zeitgeschehen auf witzige Art und Weise aufs Korn.
Quelle: Stadtarchiv Dresden, 17.4.1 Drucksammlung, Nr. 142
Sylvia Drebinger
Januar 2020
Vom Mehlspeicher zum Geschichtsspeicher der Stadt Dresden. Vor 20 Jahren bezog das Stadtarchiv die Heeresbäckerei.
Am 18. Januar 2000 öffnete das Stadtarchiv Dresden seine frisch sanierten Pforten in der ehemaligen Heeresbäckerei auf der Elisabeth-Boer-Straße 1. Der vergangene Hauptsitz auf der Marienallee im alten Kriegsarchiv der sächsischen Armee verfügte über sieben weitere Außenstellen in der Stadt seit 1945 und war stark sanierungsbedürftig. Der Stadtratsbeschluss vom 25. September 1997 bestätigte den neuen Standort des Stadtarchivs und dessen Entwicklungskonzeption mit den benötigten Finanzplanungen. Somit können seit der Zusammenführung mit den Außenstellen im Jahr 2000 und dem dazugehörigen Zwischenarchiv (2012) derzeit 42 Kilometer Archiv- und Sammlungsgut aufbewahrt werden. Darunter befinden sich 4200 Urkunden, 123 000 Karten, Pläne und Risse, 517 000 Fotos sowie 45 000 Bibliotheksbände aus der über 800-jährigen Geschichte der Stadt Dresden.
Das Gelände der ehemaligen Heeresbäckerei in der Dresdner Albertstadt umfasst ungefähr 9 ha und war Bestandteil der nach dem Deutsch-Französischen Krieg vom damaligen sächsischen Kriegsminister General von Fabrice entworfenen Garnisonsstadt. Nach 1877 wurde dieses Areal nach König Albert umbenannt. Die für das Militär konzipierte Heeresbäckerei nutzten bis 1991 die jeweiligen Militärverbände, zuletzt die Sowjetarmee. Von 1993 bis 1999 verfiel das Gebiet und eine Nutzung erfolgte nur teilweise.
Die Archivale des Monats zeigt eine Momentaufnahme des ehemaligen Mehlspeichers aus dem Jahr 1993. Professor Jörg Schöner dokumentierte im Auftrag für den Freistaat Sachen die ehemaligen GUS-Liegenschaften. 2000 zog nach der schrittweisen Sanierung des denkmalgeschützten Areals das Stadtarchiv ein. Anstelle von Mehl lagern stattdessen historische Archivalien – dazu zählen auch die zahlreichen Fotografien von Jörg Schöner. Das Stadtarchiv Dresden übernahm im September 2018 den fotografischen Bestand von Professor Schöner mit circa 32.000 Fotos. Anlässlich seines 75. Geburtstags zeigt das Stadtarchiv eine besondere Auswahl von seinen Fotografien. Die Bilder dokumentieren öffentliche Bauvorhaben des Freistaats Sachsen und der Stadt Dresden. Zu seinem Portfolio gehören ebenfalls Bilder von den Sparkassengebäuden am Güntzplatz und Altmarkt sowie von der Kreuzkirche, Hofkirche und Synagoge. Jörg Schöner entwickelte ein digitales System zur Darstellung von Fassaden- und Gebäudeoberflächen in Originalgröße. Diese Methode unterstützt Restauratoren bei Aufmaßarbeiten und bildet die Grundlage der Zustandsdokumentation des rekonstruierten Historischen Grünen Gewölbes und dem Monitoring-Programm am Dresdner Zwinger. Vervollständigt wird der Bestand durch die Übergabe seines Luftbildarchivs der Jahre 1992 bis 2011, in dem besonders die Veränderungen der Dresdner Innenstadt dokumentiert wurden.
Quelle: Stadtarchiv Dresden, 17.6.2.23, Bildarchiv, Jörg Schöner.
Annemarie Niering
Archivalien des Monats aus dem Jahr 2019
Dezember 2019
„Alle Jahre wieder“ beginnt die Jagd nach den Geschenken. Geschäftsempfehlungen für ein freudiges und stressfreies Weihnachtsfest 1893
Spätestens ab September eines jeden Jahres begegnen sie uns, die Pfefferkuchen, Weihnachtsmänner, Marzipankartoffeln und viele andere mehr. Auf diese Weise wird jedem Supermarkteinkäufer klar – es weihnachtet sehr. Dagegen hilft die alljährliche Kritik an der zunehmenden Kommerzialisierung des Weihnachtsfestes ebenso wenig wie die statistischen Erhebungen zum gewünschten Verbot eines verfrühten Verkaufes einschlägiger Weihnachtsprodukte. Nicht selten geht die Kritik mit einer Verklärung der vorangegangenen Weihnachtsfeste mit dem Duktus der „guten alten Zeit" einher, in der Besinnlichkeit, innere Einkehr und die Freude am Selbstgemachten vermeintlich im Vordergrund standen. Doch wann liegt dieser Zeitraum historisch verortet? Vor einigen Jahrzehnten oder bereits im vorletzten Jahrhundert? Versucht man dieser Frage über ihren rhetorischen Charakter hinaus nachzugehen, sieht man sich mit der Recherche nach dem Beginn der modernen Konsumgesellschaft konfrontiert.
Zwar können wir mit unserem „Archivale des Monats“ die Forschung nicht bahnbrechend vorantreiben, aber wir können anhand unserer 50-seitigen Broschüre „Unser Weihnachtsmarkt 1893/94. Wegweiser für Käufer zu empfehlenswerthen Geschäften“ einen kleinen Einblick in das Einkaufsverhalten der Dresdner für das Weihnachtsfest 1893 geben. Das aufwändig gestaltete Deckblatt stellt den Leser bereits auf die nahenden Feierlichkeiten ein und verspricht mit seiner reichen Sammlung an ebenfalls detailreich gezeichneten Geschäftsempfehlungen die Suche nach dem richtigen Geschenk für Freunde und Familie zu verkürzen. Empfohlen wurden Leckereien wie Schokolade und Kakao der Firma „Jordan & Timaeus“, edle Taschenuhren und Stiefel für den Herrn, Schmuckstücke und Einrichtungsgegenstände für die Dame, Kinderfahrräder der Firma „Seidel & Naumann“ sowie Musikinstrumente und Künstlerbedarf. Die Broschüre leistete aber durchaus mehr und vermittelte mit einem mehrseitigen Bericht über die Sehenswürdigkeiten der Stadt ein kulturelles Angebot, das an den freien Tagen mit möglichen Feiertagsgästen genutzt werden konnte. Zum Service der Broschüre gehörte ebenfalls eine Auflistung der Theater- und Opernhäuser, die zugleich mit einem Sitzplan und passenden Preiskategorien ausgestattet war. Darüber hinaus garantierten Fahrpläne für Straßenbahnen und Omnibusse eine sichere An- und Abreise. Auch die Angabe der anfallenden Portogebühren beim Paketversand sollte die Besorgung der Weihnachtsgeschenke vereinfachen. Der Kauf von Geschenken spielte augenscheinlich bereits am Ende des 19. Jahrhunderts eine wichtige Rolle. Auch wenn die Tradition des Geschenkes bereits seit dem Mittelalter verbrieft ist, kann über die Jahrhunderte hinweg ein Wandel im Stellenwert der Präsente nachvollzogen werden. Beeinflusst wird die Geschichte der Geschenke insbesondere durch die Tatsache, dass diese ursprünglich selbst gefertigt und nicht gekauft wurden. Ein Blick in die Werbeannoncen um 1800 bestätigt, dass das Weihnachtsfest beziehungsweise der Nikolaustag den Handel zu dieser Zeit kaum tangierte. Einen wahren Boom erlebte die „Geschenkelobby“ in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, befördert durch die Industrialisierung zahlreicher Gewerbezweige. Ein reich gedeckter Gabentisch und ein ausgeprägtes Festmahl fanden sich aber keineswegs in jeder Stube, auch wenn die Produktvielfalt der Geschäftsempfehlungen dies suggerierten. Die Kinder weniger gut situierter Familien gingen häufig leer aus oder erhielten Selbstgemachtes wie beispielsweise Handschuhe oder Holzspielzeuge. In ihrem Weihnachtsfest überlebt die Tradition vom Selbstgemachten bis in die heutige Zeit hinein und verspricht uns allen „So viel Heimlichkeit in der Weihnachtszeit“.
Quelle: Stadtarchiv Dresden, 18 Wissenschaftlich-Stadtgeschichtliche Fachbibliothek, Hist. Dresd. 1875.
Sylvia Drebinger
November 2019
Die Individualität der Ansichtskarte.Vor 90 Jahren wurde der Bau des Hochhauses am Albertplatz auf einer Ansichtskarte verewigt
Als am 1. Oktober 1869, vor 150 Jahren, die österreichisch-ungarische Post die „Correspondenz-Karte“ eingeführt wurde, traf sie damit genau den Zeitgeist der Bevölkerung nach kurzer bildlicher Kommunikation. Schon in den 1870er Jahren kam die Idee auf, das neue Medium zum populären Bildträger weiterzuentwickeln. Kaum ein Thema wurde ausgespart: Gruß- und Glückwunschkarten, Ansichten von Landschaften, Städten und Dörfern. Abgebildet wurden Vergnügungsorte, Kunst, Sport, Liebe, Erotik und Humor. Die Bandbreite umfasste ebenso Bilder aus der Politik und technische Errungenschaften. Der Ausdruck der Individualität ging soweit, dass sogar der Rohbau des Hochhauses am Albertplatz auf einer Ansichtskarte abgebildet wurde, die im Stadtarchiv im November vor dem Lesesaal ausgestellt ist.
Noch heute prägt das markante Gebäude die Silhouette des Albertplatzes und bildet den Eingang in die Äußere Neustadt. Der Stahlbeton-Skelettbau wurde im Jahr 1929, vor 90 Jahren, nach Plänen von Hermann Paulick für den Regierungsrat Dr. Alfred Hesse geschaffen. Als Bauherr hatte Hesse ursprünglich andere Vorstellungen über die architektonische Bauausführung. Vorgesehen war eine zeittypische Eckbebauung mit Gewerbe- und Wohnnutzung in fünf Geschossen. Erst später veränderte man die Entwürfe und entschloss sich, ein Hochhaus zu bauen. Das Gebäude am Albertplatz ist damit das älteste Bürohochhaus in Dresden.
Auf der Postkarte lässt sich am Baugerüst ein Schriftzug erkennen, auf dem zu lesen ist „Wer schnell bauen will – baut in Betonskelett“. Für die Bauausführung des Hochhauses konnte mit Benno Löser ein anerkannter Betonfachmann gewonnen werden, der schon das Stahlbetonskelett der Yenidze konzipierte. Löser schaffte es mit dem seinerzeit neuen frühhochfesten Zement, jede Woche ein Geschoss zu vollenden. Das elfgeschossige und 37 Meter hohe Verwaltungsgebäude fand in der Sächsischen Staatsbank in den Jahren von 1929 bis 1945 seinen Hauptnutzer. Bei den Luftangriffen 1945 wurde das Hochhaus beschädigt, aber nicht zerstört. Laut Bauakte waren „durch Bombenwirkung Teilschäden an der Umfassung, sehr viel eingedrückte Scheidewände, fast sämtliche Türen, Fenster und Parkettfußböden zertrümmert und verbrannt, die Dächer stark beschädigt“.
Schon im August 1945 ging man an den Wiederaufbau, indem man den Ausbau einer Zahlstelle der Sächsischen Landesbank sowie Räume für die Dresdner Straßenbahn AG plante, um die Straßenbahnverwaltung, die bisher im Alten Rathaus untergebracht war, hier einziehen zu lassen. Knapp fünf Jahrzehnte war das Hochhaus dann bis 1996 Verwaltungssitz der Dresdner Verkehrsbetriebe. Heute beherbergt das Hochhaus auf vier Etagen das Museum „Die Welt der DDR“.
Quelle: 17.6.1 Ansichtskartensammlung, SN071
Marco Iwanzeck
Oktober 2018
„..eine heimbliche und verborgene Entzündung..“ Vor 350 Jahren verursachten Blitze eine Feuersbrunst in der Kreuzkirche
Am 29. April 1669 erschütterte gegen 22 Uhr ein mächtiger Donnerschlag den Himmel über Dresden. Zugleich durchschlugen mehrere Blitze die Fenster in der Stube des Stadtpfeifers und der darüber liegenden Kammer im Turm der Kreuzkirche, sodass das Fensterblei zerschmolz und sich ein Leinentuch entzündete. Außerdem fuhr der „ein oder andere Strahl“ in die Turmspitze, wodurch sich im Inneren des Turmes eine „heimbliche und verborgene Entzündung“ entfaltete. Daher wurde das glimmende Feuer zunächst nicht wahrgenommen. Vielmehr vermuteten Zeugen, dass der dezente Lichtschein im Turm durch die Laternen der Wächter bei ihrem Kontrollgang verursacht wurde. Erst das „Geschrey von der Gaßen“ machte auf das Feuer aufmerksam, das aber nun schon „mit voller Lohe“ aus allen Seiten des Turms herausstob.
Zur Alarmierung der Einwohnerschaft wurde die große Seigerschelle im Turm geläutet, wobei unglücklicherweise auch noch Glut auf die darunterliegende hölzerne Haube fiel, die in kurzer Zeit in vollen Brand geriet. Damit wurde eine rechtzeitige Erstickung der Flammen aussichtlos. Nach etwa eineinhalb Stunden stürzte die zermürbte Turmspitze samt Knopf und Kreuz auf das benachbarte Eckhaus und gegen den Seitenturm der Kreuzkirche, der dadurch gleichsam Feuer fing. Außerdem zerschmetterten herabstürzende brennende Balken und Teile des steinernen Geländers „mit großem Gepraßel“ das Kirchdach und drohten, auch dieses in Brand zu setzen. Die Bürger und Handwerker der Stadt bekämpften die Flammen nach Leibeskräften, allerdings mussten sie das Wasser von Hand zu Hand über die zahlreichen Turmtreppen zu den Brandherden reichen.
Das Feuer loderte daher allein sechs Stunden lang „liechter lohe“ und die gesamten Löscharbeiten dauerten noch bis zum 1. Mai 1669 an. Dadurch wurde die Kirche zu guter Letzt noch völlig überschwemmt. Ungeachtet der verbrannten, hölzernen Bauteile war das Mauerwerk aus Pirnaer Sandstein durch die Hitze geborsten, durch herabgestürzte Trümmer stark beschädigt und durch das Löschwasser durchweicht. Einige Turmglocken, das Uhrwerk und die vier auf dem Turm zur Stadtverteidigung aufgestellten Kanonen, sogenannte Feldschlangen, waren durch den Brand gänzlich zerschmolzen und das Metall im Inneren der Kirche überall versprengt. Am Morgen des 1. Mai 1669 wurde sofort mit der Sicherung des stark beschädigten Gebäudes begonnen. Der Wiederaufbau, der durchweg von dem Bürgermeister und Brückenamtsverwalter Paul Zincke (1608 – 1678) geleitet wurde, dauerte schließlich mehr als fünf Jahre, bevor im November 1674 die Kreuzkirche wieder in neuem Glanz erstrahlen konnte. Im Übrigen zersprang beim Einsturz auch der Turmknopf und offenbarte diverse goldene und silberne Objekte, die der eifrige Festungsobrist Johann Siegmund von Liebenau (1607 – 1671) umgehend beschlagnahmte. Genaueres zum Inhalt des Turmknopfes kann in diesem Monat im Lesesaal des Stadtarchivs nachgelesen werden.
Quelle: Grimmer, Ch. F. (Hg.): Abbildungen von Dresdens alten und neuen Pracht-Gebäuden, Volks- und Hof-Festen, Dresden 1835, Fol. 73.
Johannes Wendt
September 2019
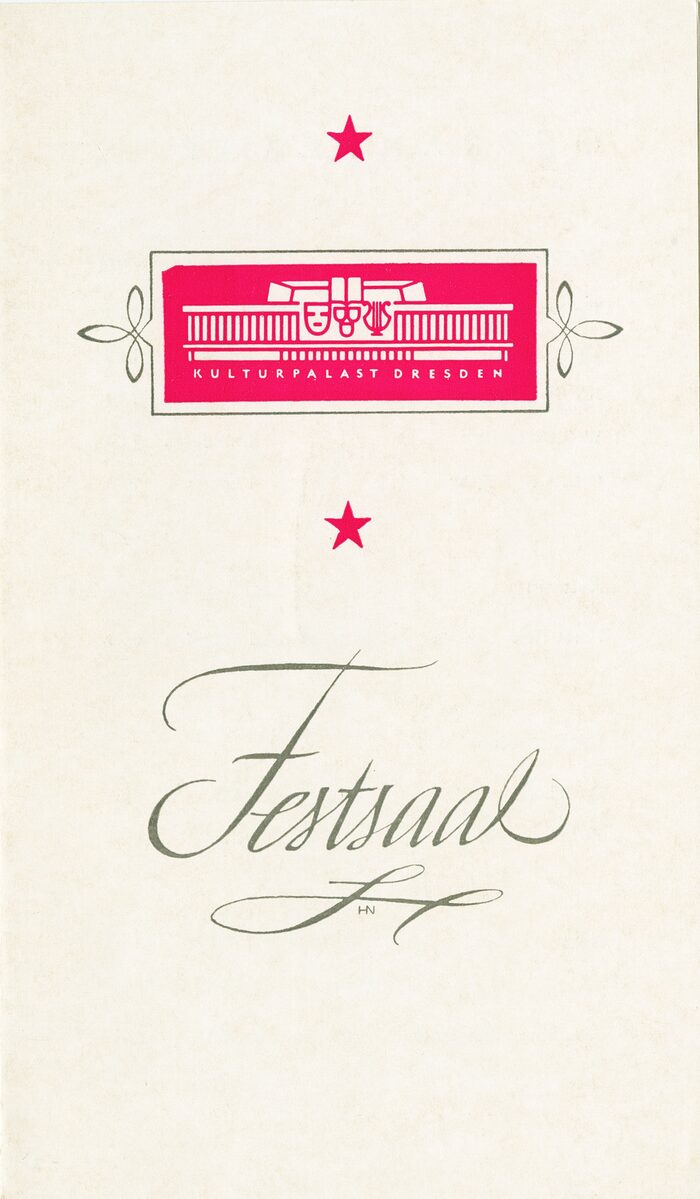
"Flambieren und tranchieren - zur Kulinarik im Kulturpalast"
„Seit Monaten freue ich mich auf den Augenblick, wo wir Leute vom Bau als erste im festlichen Saal des Kulturpalastes sitzen werden.“ Tage später betitelte die „Sächsische Zeitung“: „Ein Juwel großen Ausmaßes präsentiert sich am Altmarkt […] Bauarbeiter übergaben drei Monate vorfristig.“
Im September 1969 berichtete die Presse beinah täglich über die städtebaulichen Errungenschaften im Dresdner Stadtzentrum. Am 5. Oktober 1969 war es dann soweit, pünktlich vor dem 20. Jahrestag der DDR, eröffnete der Kulturpalast und war seitdem zentraler Austragungsort des kulturellen- und politischen Lebens. Zu den kulturellen Ereignissen zählten auch die alljährlich stattfindenden Silvester-Veranstaltungen, die den krönenden Abschluss eines Jahres bildeten. Die Köche des Hauses gestalteten Menüs, die den feierlichen Abend kulinarisch hervorhoben. Seit Eröffnung des Kulturpalastes galt die Preisstufe III im Restaurant, ausgenommen waren Sonderveranstaltungen wie die zum Jahreswechsel. An den Abenden dinierten die Gäste nach der Preisstufe Sonderklasse. Innerhalb der DDR-Gastronomie galt ein Klassifizierungssystem mit Preisstufen nach den Kategorien I bis IV, darüber hinaus rangierten die Restaurants der Sonderklasse. Je höher die Kategorie, desto umfangreicher und qualitativ hochwertiger war das Angebot an Speisen und Getränken. Beispielhaft dafür servierte das Fachpersonal 1972 ein Silvester Menü aus insgesamt fünf Gängen. Die Gäste erhielten als Erstes einen „Toscasalat" und als zweiten Gang eine Kraftbrühe „Royal“. Der Bratengang „Storchennest“ bestand aus Kartoffelnestern, einer Schweins- und Rindslende mit Champignonköpfen. Als Süßspeise folgte der Eisbecher „Silvester" und abschliessend Pfannkuchen. Im Jahr 1973 konnten die Gäste zwischen zwei Gedecken auswählen. Das erste Silvester-Gedeck eröffnete die Speisenfolge mit zwei Wachteleiern garniert auf Remoulade. Danach servierten die Kellnerinnen und Kellner eine Känguruschwanzsuppe sowie als dritten Gang eine glacierte Putenbrust mit Rosenkohl und Kartoffelbällchen. Die Eisschale „Silvester“ vollendete den kulinarischen Abend. Das zweite Silvester-Gedeck unterschied sich ausschließlich im Hauptgang. Ein gespicktes Kalbsfricandeau „Gärtnerinart“ mit Schloßkartoffeln gelangte hier auf die feierliche Tafel der Gäste. Charakteristisch für die gehobenen Restaurants der Preisstufe IV bis zur Sonderklasse war die Warenbelieferung von qualitativ hochwertigen Produkten wie beispielsweise die Fleischsorten Rind und Kalb. Hinzu kamen wie im „Restaurant Kulturpalast“ die gastronomischen Sonderleistungen. Dem Anlass entsprechend wendeten die Kellnerinnen und Kellner den englischen oder französischen Service an. Dazu gehörte auch das Flambieren und Tranchieren vor dem Gast. Zu den Qualitätsmerkmalen zählte außerdem das Angebot gedruckter Speisen- und Getränkekarten mit Tageskarten. Diese wurden in der Regel wie die Abbildung zeigt, schlicht gestaltet. Kennzeichnend besaßen sämtliche Restaurantkarten das prägnante Logo des Kulturpalastes.
Das historische „Restaurant Kulturpalast“ mit der dazugehörigen Küche befand sich in den heutigen Räumen der Zentralbibliothek im ersten Obergeschoß. Daneben schloss sich eine Kantine für die Belegschaft des Hauses sowie ein kleiner und großer Gesellschaftsraum für Besucher an. Nach der Sanierung von 2013 bis 2017 ist die besondere Deckengestaltung des Restaurants und der handgewebte Gobelin „Heitere Reminiszenzen aus Dresden“ von Christa Engler-Feldmann gesichert und erhalten geblieben.
Quelle: Stadtarchiv Dresden, 17.2.58, Sammlung Kulinarisches.
Annemarie Niering
August 2019

Keine „unerfahrnen und ungeschickten Purschen“!
Vor 200 Jahren wurde die Dresdner Fiacre-Anstalt gegründet
Als im Jahr 1818 der Berliner Unternehmer Alexi Mortgen den sächsischen König um die Einräumung eines Privilegs für die Einrichtung eines Mietkutschendienstes in Dresden ersuchte, waren die Dresdner Lohnkutscher in hellem Aufruhr. Umgehend wurde mit Blick auf die „Concurrenz fremder Entrepreneurs“ durch das Stadtpolizei-Kollegium ein Regulativ für eine lokale „freiwillige Fiacre-Anstalt“ entworfen, um das einheimische Lohnkutschergewerbe zu schützen. Die Fiacre-Anstalt war eine Vereinigung von Dresdner Lohnkutschern, die das Privileg genossen, Fahrgäste spontan und kostenpflichtig mit der Droschke in Dresden befördern zu dürfen. Frühere Versuche zur Etablierung einer ähnlichen Körperschaft waren zuvor nicht nur am Widerstand der Chaisenträger, sondern auch an der fehlenden Nachfrage gescheitert, denn auf Grund der Straßenverhältnisse waren die Sänften komfortabler und flexibler einsetzbar.
Die Fiaker als Vorläufer der Taxis ermöglichten auch dem allgemeinen Publikum und insbesondere Gästen, spontan, „ohne cörperliche Ermüdung“ und in kurzer Zeit an den zahlreichen, auch weiter entfernten Natur- und Kulturschätzen der sächsischen Residenz und des Umlandes zu partizipieren. Gemäß des Regulatives vom 6. September 1819, dass sich inhaltlich an bereits bestehenden Ordnungen aus anderen Städten wie Augsburg, Berlin und Wien orientierte, mussten die Mitglieder der Anstalt ortsansässig sein und durften keinen sonstigen Erwerb haben. Die Fiaker sollten „von leichter, aber solider Bauart“, „reinlich“ und mit einer eindeutigen Nummer in weißer Ölfarbe gekennzeichnet sein. „Scheue und nicht eingefahrene“ Pferde sowie „unerfahrne und ungeschickte Purschen“ durften ausdrücklich nicht zum Einsatz kommen. Zunächst wurden drei Standorte für die Fiaker bestimmt: auf dem Neumarkt, im italienischen Dörfchen auf dem heutigen Theaterplatz und auf dem Neustädter Markt.
Die Kutscher waren verpflichtet, „ein bescheidenes und höfliches Benehmen“ an den Tag zu legen und „auf Verlangen eines Fahrlustigen“ die Fahrt anzutreten - eine Weigerung konnte sogar mit Gefängnisstrafe geahndet werden. Längere Fahrtzeiten als eine Stunde für einen Einspänner und drei Stunden für einen Zweispänner hingen hingegen von der „Willkühr“ der Kutscher ab. Die Geschwindigkeit sollte bei den Fahrten einen „guten Trab“ betragen. Die Fahrtkosten richteten sich streng nach einer pro Fahrgast festgelegten „Taxe“, eine Annahme von Trinkgeldern war bei Androhung einer „harten Ahndung“ verboten. Zustiege in einen besetzten Fiaker waren nur mit Einwilligung der vorhandenen Fahrgäste möglich, allerdings mussten diese bei Nichteinwilligung auch für den entgangenen Verdienst aufkommen. Eine Einzelfahrt kostete höchstens bis zu acht Groschen pro halbe Stunde, das entsprach in etwa dem Tagesverdienst eines Maurergesellen. Für Wartezeiten über 15 Minuten und Kinder bis 10 Jahren wurde übrigens die Hälfte der Taxe veranschlagt.
Quelle: Stadtarchiv Dresden, 6.4.40.2, Stadtplanungsamt Bildstelle, Nr. V17, unbekannter Fotograf, undatiert, bearbeitet.
Johannes Wendt
Juli 2019
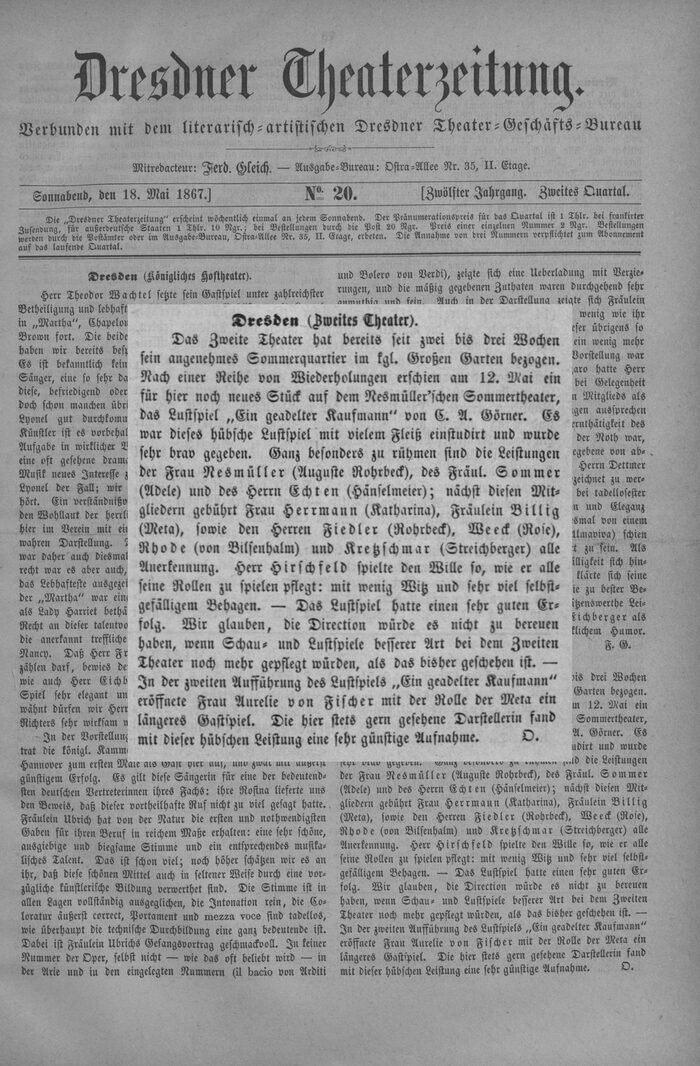
Theater in Dresden
Die Sommersaison 1867 im Königlichen Großen Garten ist eröffnet
Vor 135 Jahren verlor Dresden sein zum damaligen Zeitpunkt einzig noch verbliebenes Sommertheater. Das Nesmüllersche Sommertheater wurde 1856 im Großen Garten in dem von Querallee, Südallee, Zoologischem Garten und Großer Wirtschaft eingerahmten Areal erbaut und im Sommer 1884 abgerissen. Das Archivale des Monats Juli präsentiert das Titelblatt der Dresdner Theaterzeitung vom 18. Mai 1867. Darin wird auf die Eröffnung der Sommersaison des Zweiten Theaters im Großen Garten Bezug genommen und das neu einstudierte Lustspiel „Ein geadelter Kaufmann“ besprochen.
Der Eigentümer und Namensgeber war der aus Mähren stammende bedeutende Schauspieldirektor, Bühnendichter, Schauspieler und Tänzer Joseph Franz Ferdinand Müller genannt Nesmüller. Er gastierte ab 1850 wiederholt in Dresden, ließ sich schließlich hier nieder, erwarb das Bürgerrecht und gründete das Zweite Theater, das seinen Sitz im Gewandhaus hatte. In den Monaten von Mai bis Ende September bespielte Nesmüller außerdem das Sommertheater im Großen Garten. Bedauerlicherweise ist nur eine einzige Abbildung dieser Bühne überliefert, die uns zeigt, dass es sich um ein so genanntes Tivoli-Theater handelte, also um ein Theater mit unbedecktem Zuschauerraum. So sehr sich Nesmüller künstlerisch hervortat – unter anderem fanden zahlreiche Werke Offenbachs und Suppés ihre Dresdner Erstaufführung in Nesmüllers Haus – so schwierig blieb die Finanzierung seiner Bühnen. Schließlich musste Nesmüller im Jahr 1881 Konkurs anmelden, und die Königliche Kreishauptmannschaft Dresden entzog ihm die Theaterkonzession.
Die letzte Aufführung im Sommertheater fand am 10. Juli 1881 statt. Das Gebäude sollte zufolge einer früheren Entscheidung abgerissen werden. Mehrere Gläubiger Nesmüllers richteten im Januar 1884 jedoch eine Petition an die Ständeversammlung des Königsreichs Sachsen und ersuchten um Weiterbetrieb des Sommertheaters, da das Theatergebäude „bei den übrigen Verhältnissen Nesmüllers“ das einzige Objekt sei, durch welches sie „einige Deckung erhalten können“. Außerdem war es die einzige Sommerbühne in ganz Dresden, ein „anerkannt praktisch und geschmackvoll angelegtes Haus in der herrlichsten Umgebung, in einem geradezu berühmten Rosengarten“, das künftig unter der Regie des Theaterdirektors Karl von Neuem erblühen sollte. Die Petenten erklärten sich ausdrücklich dazu bereit, die notwendigen baulichen Veränderungen am Sommertheater zu veranlassen, um damit den Bestimmungen der 1882 in Kraft getretenen Verordnung über die Sicherung der Schauspielhäuser gegen Feuersgefahr Genüge zu tun. Der Architekt und königliche Baurat Ernst Giese erstellte ein Gutachten über die bauliche Beschaffenheit des Sommertheaters und listete darin Vorschläge zur Verbesserung des Brandschutzes auf.
Trotz aller Bemühungen kam es im Sommer 1884 zum Abriss des Theaters. In den darauffolgenden Jahren wurde das Gelände in die Umgestaltung des Großen Gartens durch Johann Carl Friedrich Bouché einbezogen.
Quelle: Stadtarchiv Dresden, Bestand 18 Stadtgeschichtliche Fachbibliothek, Sign. Z.214
Claudia Richert
Juni 2019

Eine Schulzahnklinik auf vier Rädern
Das Schwelmer Vorbild – ein Nachahmungsmodell für Dresden?
Mit dem freudigen Aufmacher „Juchhei, juchhei, das ist gewiß, ich brauche später kein Gebiß!“ berichtete der Sonderabdruck des „Schwelmer Tageblattes“ vom 27. April 1929 über die Einrichtung einer neuen Schulzahnklinik in Schwelm. Das Besondere daran war allerdings die Unterbringung der Zahnarztpraxis in einem Wagenaufbau, der auf einen Mercedes-Benz mit Niederrahmen-Fahrgestell und Sechszylindermotor montiert wurde. Wie die Fotografien in einer Akte des Dresdner Schulamtes zeigen, befand sich in dem Wagen eine modern eingerichtete Zahnklinik mit elektrischer Beleuchtung, Warmwasserbereiter, Abwassertank und Heizung. Außerdem waren ein Schreibtisch, ein Kinderuntersuchungsstuhl, ein Waschbecken sowie ein Wartebereich mit zwei ausklappbaren Sitzen eingebaut. Die Stromversorgung erfolgte über einen Anschluss an die Starkstromleitung der Schule.
Diese Erfindung von Prof. Kantorowicz aus Bonn weckte auch das Interesse des Dresdner Finanzamtes, welches darin eine mögliche finanzielle Entlastung sah und das Schulamt bat, sich mit der Beschaffung eines solchen Wagens zu befassen. In Dresden existierte bereits seit 1921 eine Städtische Schulzahnklinik mit zwei Zweigstellen in Cotta und Pieschen in denen alle Schüler der Klassenstufen 2 bis 5 eine kostenfreie Untersuchung erhielten. Dresden besaß damit als eine der wenigen Großstädte eine die gesamte Volksschuljugend umfassende Schulzahnpflege. Aufgrund der sehr guten Auslastung war eine dritte Zweigstelle in Planung, welche gegebenenfalls durch den zahnärztlichen Wagen ersetzt werden sollte.
Für eine solche mobile Zahnklinik sprach aus Sicht des Dresdner Schulamtes lediglich, dass der Schulzahnarzt auch vor die kleinste Dorfschule fahren konnte und die Kinder nicht in eine weit entfernte Landstation gebracht werden mussten. Allerdings würden die Kosten von ca. 12 200 RM für eine stationäre Einrichtung weit unter denen eines zahnärztlichen Automobils in Höhe von 23 000 RM liegen. Auch seien höhere Personalkosten zu erwarten, da man neben dem Zahnarzt und einer Schwester zusätzlich einen Kraftwagenführer einstellen müsse. Darüber hinaus wurde bezweifelt, dass der Zahnarzt an kalten Wintertagen ohne gesundheitliche Schäden arbeiten könne. Ebenfalls unklar war der Stellplatz des Wagens. Die öffentlichen Verkehrswege neben der Schule durften keinesfalls durch das über den Gehweg liegende Stromkabel, wartende oder schreiende Kinder behindert werden. In die Schulhöfe konnte der schwere Wagen aber auch nicht fahren, da die Reifen den ungepflasterten Boden zerstören würden.
Aus der Akte geht hervor, dass das Dresdner Schulamt alles in allem zu dem Schluss kommt, die Frage der Automobil-Schulzahnklinik vorerst auf sich beruhen zu lassen und abzuwarten, ob die Idee aus Schwelm zwei Winter übersteht. Die zunehmend schwierige finanzielle Lage der Stadt ab 1929 führte in den folgenden Jahren dazu, dass die fahrende Schulzahnklinik nie wieder zur Debatte stand und auch keine dritte stationäre Zweigstelle eingerichtet wurde.
Quelle: Stadtarchiv Dresden, 2.3.20 Schulamt, Nr. 0368
Sophie Richter
Mai 2019
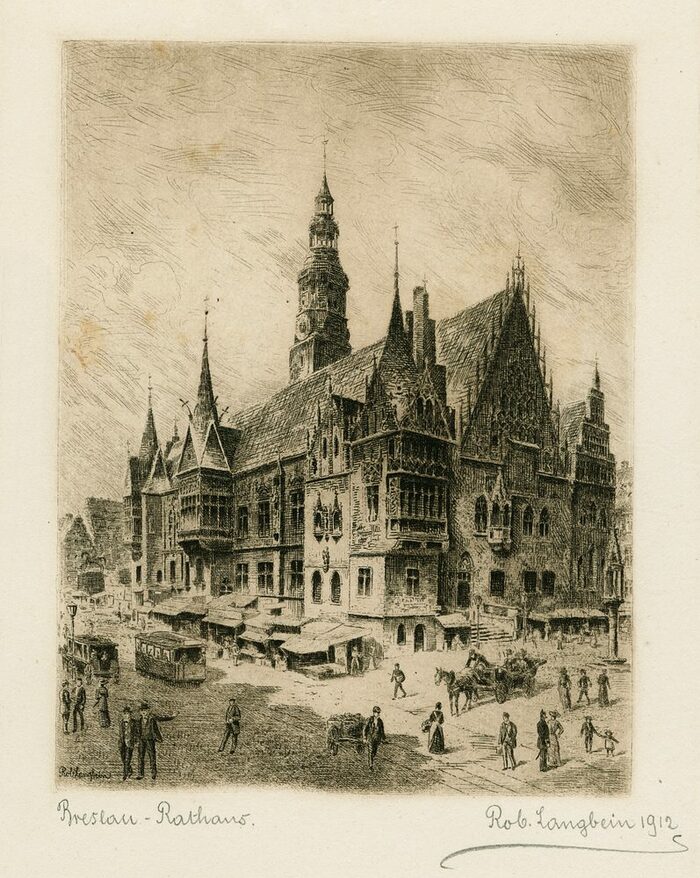
60 Jahre Städtepartnerschaft zwischen Breslau und Dresden
Mit Blick auf einige außergewöhnliche Festkarten
Am 7. Mai 1959 wurde zwischen Wrocław und Dresden ein Abkommen über die kulturelle und gesellschaftliche Zusammenarbeit von Bolesław Iwaszkiewicz (1902-1983), Vorsitzender des Präsidiums des Nationalrates der Stadt Wrocław, und Herbert Gute (1905-1975), Oberbürgermeister der Stadt Dresden, unterzeichnet. In der zeittypischen Stilisierung wurde in der Präambel des Vertrages die zweitälteste Städtepartnerschaft Dresdens begründet, „von dem Willen erfüllt, die Freundschaft zwischen den Städten Wrocław und Dresden zu festigen, und sich gegenseitig beim Aufbau des Sozialismus zu unterstützen“. Hierzu wurde ein ständiger Erfahrungsaustausch auf allen Gebieten des gesellschaftlichen, ökonomischen und kulturellen Lebens avisiert. Besonderes Interesse galt unter anderem der Wohnungswirtschaft, der „unterirdischen Ausstattung der Stadt“, der Bevölkerungsversorgung, dem Gesundheitswesen sowie der Bildung, der Kultur und dem Sport. Hierfür waren Delegationsbesuche, Konsultationen, künstlerische und studentische Erfahrungsaustausche, sportliche Wettbewerbe sowie Schülerkorrespondenzen vorgesehen. Nach der Wiedervereinigung wurde dann die Fortsetzung und Intensivierung der gemeinschaftlichen Aktivitäten mit der novellierten Vereinbarung vom 27. August 1994 „in Anbetracht der traditionell guten, freundschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Städten“ konsolidiert.
Mit Blick auf die 60jährige Freundschaft werden in diesem Monat Muster besonderer Ratsfestkarten von Robert Langbein (1864-1932) im Lesesaal des Stadtarchivs präsentiert. Der Maler und Radierer warb im Jahr 1912 mit Kunstdrucken vom Breslauer Rathaus beim Dresdner Rat, um einen Auftrag zur Anfertigung von äquivalenten Festkarten für Dresden zu erhalten. Auf der Suche nach einer grafischen Vorlage stellte Stadtbaurat Professor Hans Erlwein (1872-1914) allerdings fest, dass die Auswahl aus Mangel eines geeigneten Aufnahmestandpunktes sehr eingeschränkt wäre, weil das Rathaus „frei und auf einem architektonisch nicht geschlossenen Platz im Stadtbild“ stand. Langbein verwendete schließlich zehn Fotografien und einige Postkarten für den Entwurf des Motivs für die Ratsfestkarten, die zunächst in einer Stückzahl von 500 in hellbrauner Tönung gefertigt wurden. 280 Stück fanden bereits zum Festmahl anlässlich des Geburtstages von Kaiser Wilhelm II. (1859-1941) am 27. Januar 1913 als Menükarten Verwendung. Allerdings blieben die übrigen Exemplare mindestens die folgenden 12 Jahre ungenutzt. Dennoch wurde unter ausdrücklicher Berücksichtigung der sozialen Notlage des Künstlers im Jahr 1927 noch eine weitere Charge von etwa 500 Stück mit einem neuen Rathausmotiv in Auftrag gegeben.
Quelle: Stadtarchiv Dresden, 2.3.1, Hauptkanzlei, Nr. 540.
Johannes Wendt
April 2019
„Ausführliches bringen die täglich erscheinenden Wetterkarten des öffentlichen Wetterdienstes zu Dresden“ – Die Einführung des öffentlichen Wetter-Nachrichten-Dienstes
Als Erfinder der Wetterkarte gilt der französische Naturwissenschaftler Urbain Le Verrier (1811–1877). Dieser erstellte am 19. Februar 1855 die erste auf telegrafisch mitgeteilten Daten basierende Vorhersagenkarte für Frankreich. Im Nachgang der erfolgreichen Präsentation des Projektes vor der Pariser Akademie der Wissenschaften entstand der meteorologische Wetterdienst in Frankreich und auch auf dem Gebiet des ab 1871 gegründeten Deutschen Reiches wurden meteorologische Forschungen befördert.
Bereits um 1878 finden sich in den Verhandlungen der Stadtverordneten von Dresden Beschlüsse zur Veröffentlichung telegrafischer Wetterprognosen. Diese gingen auf die Angaben der in Leipzig ansässigen meteorologischen Centralstation für Sachsen unter Leitung des Geheimrates Dr. Carl Christian Bruhns (1830–1881) zurück. Täglich um 16 Uhr sollten sämtliche in Europa befindlichen meteorologischen Hauptstationen einen Wetterbericht nach Leipzig senden. Vor Ort erfolgten die Auswertung der Berichte und die Aufstellung einer für 24 Stunden gültigen Wetterprognose, deren Wahrheitsgehalt auf 70 % geschätzt wurde. Die Angaben wurden unter anderem nach Dresden telegrafiert, so dass ab 18 Uhr der Aushang an öffentlichen Plätzen wie dem Altstädter und dem Neustädter Rathaus erfolgte. Durch Zusammenarbeit aller Regierungen der Bundesstaaten des Deutschen Reiches wurde die Einführung eines einheitlich gestalteten „öffentlichen Wetter-Nachrichten-Dienstes“ festgelegt. Maßnahmen zur Durchsetzung dieses öffentlichen Wetterdienstes wurden in Sachsen ab dem 31. Mai des Jahres 1906 durch das Königliche Ministerium des Inneren ergriffen.
Neben den bereits etablierten telegrafierten Wettervorhersagen, die sich auf Wind, Bewölkung, Niederschlag und Temperatur bezogen, sollten zusätzliche Wetterkarten des öffentlichen Wetterdienstes zu Dresden angebracht werden. Die Wetterkarten waren Landkarten, die mit einfachen am Rande erläuterten Zeichen die Verteilung des Luftdruckes über Europa darstellten und Rückschlüsse auf hiesige Witterungsvorgänge ermöglichten. Die umfassende Weitergabe aktueller Wetterinformationen, deren besonderer Wert vor allem für die Landwirtschaft betont wurde, sollte über Schaukästen erfolgen, die an öffentlichen Orten – insbesondere an den Außenwänden der Postanstalten – aber auch an Bahnhöfen, Schulen oder Gemeindeämtern aufgehängt wurden. Während die Wetterkartenabonnements mit 50 Pfennig monatlich kostengünstig zu haben waren, erregte die Anschaffung der Kästen, die für das Aushängen des Wettertelegrammes und drei Wetterkarten vorgesehen waren, den Unmut einzelner Gemeinden. Nicht nur die Kosten von 8 Mark pro Kasten, sondern auch Aufhängung, Glasscheiben und wetterfester Anstrich sollten von der Gemeinde getragen werden. Diese Maßnahmen missfielen insbesondere dem Rats- und Verwaltungsausschuss von Laubegast und Cossebaude, die dem Gemeinderat kurzerhand empfahlen, die Maßnahmen unter Verweis auf mangelnde Landarbeit in ihrer Region abzulehnen.
Quelle: Stadtarchiv Dresden, 2.3.9 Gewerbeamt A, Nr. S.0338.
Sylvia Drebinger
März 2019
Heimatschein für Meyer Salomon. Ein Dresdner Antiquitätenhändler erhält das Bürgerrecht
Am 1. Februar 1855 erhielt der Dresdner Antiquitätenhändler Meyer Salomon die Urkunde über seine Zugehörigkeit zum Heimatbezirk Dresden. Es handelt sich um ein äußerlich schlicht gestaltetes Schriftstück, das die Unterschrift des damaligen Oberbürgermeisters Pfotenhauer trägt. Auffällig ist der sehr schön geprägte Abdruck eines Siegels des Rates der Königlichen Residenz- und Hauptstadt Dresden. Das sächsische Heimatgesetz von 1834 bestimmte, dass jeder Staatsangehörige des Königreiches Sachsen die Zugehörigkeit zu einem Heimatbezirk besitzen sollte. Die Heimatangehörigkeit wurde bei der „Ortsobrigkeit“ beantragt. Diese stellte nach entsprechender Prüfung den sogenannten Heimatschein aus.
Meyer Salomon, der Gründer der bekannten Antiquitätenhandlung M. Salomon, die sich im Laufe der Jahrzehnte in Museumskreisen und Auktionshäusern hohes Ansehen erwarb, beantragte das Bürgerrecht der Stadt Dresden, verbunden mit einer Konzession zur Betreibung des Antiquitätengeschäftes, erst im Mai 1854, obwohl er 1809 in Dresden geboren wurde, bereits seit 1834 im „Handel mit alten Sachen“ tätig war und inzwischen eine große Familie zu ernähren hatte. Nachdem sein erster Antrag offenbar unbeantwortet blieb, verfasste er im September 1854 ein zweites Schreiben, in welchem er ausführlich seinen Werdegang und die Gründe für den Antrag darlegte. Offenbar war er von der Königlichen Polizeidirektion aufgefordert worden, seine „Berechtigung zum Antiquitätenhandel durch obrigkeitliche Concession nachzuweisen“. Er entschuldigte sein Versäumnis mit dem „Drange der Geschäfte“ und fügte ein Zeugnis des Direktors der Königlichen Porzellansammlung Dr. Graesse bei.
Im frühen 19. Jahrhundert war Angehörigen der israelitischen Gemeinde die Erlernung eines Handwerks untersagt. Während vermögendere Glaubensgenossen Medizin studieren konnten, blieb den ärmeren Klassen nichts weiter übrig, als sich durch den Handel mit alten Sachen „kümmerlich zu ernähren“. Auch Meyer Salomon hielten die Mittellosigkeit seines Vaters und die „Rechtlosigkeit seines Glaubens“ davon ab, ein Studium oder eine handwerkliche Ausbildung aufzunehmen. Erst das „Gesetz wegen einiger Modificationen in den bürgerlichen Verhältnissen der Juden“ vom 16. August 1838 brachte einige Verbesserungen. Unter anderem durften sich inländische Juden künftig dauerhaft in Dresden und Leipzig aufhalten, dort auch ein Grundstück erwerben sowie das Bürgerrecht zur Betreibung eines Gewerbes beantragen.
Meyer Salomon schilderte, wie er dem Trödel mit alten Sachen zunächst nur widerwillig nachging, jedoch schließlich im Antiquitätenhandel eine Berufung fand, die den Sinn für Bildung in ihm weckte und es ihm erlaubte, „mit Kunstfreunden und Männern der Wissenschaft vielfach geschäftlich zu verkehren“. Er betonte, dass er mit Gegenständen handelte, die „durch hohes Alter und ihre besonderen Formen ein historisch-wissenschaftliches Interesse haben, wie Gefäße, Waffen, Münzen, Gemälde“. Nach seinem Tod im Jahr 1863 führte sein Sohn Edmund das Geschäft weiter. Die Firma M. Salomon bestand bis in die 1930er Jahre. Der letzte Inhaber, Eugen Abraham Salomon, verließ Dresden wahrscheinlich 1934 mit einem kurzen Zwischenhalt in Amsterdam und ließ sich schließlich in London nieder. Möglicherweise vorhandene Akten über das Schicksal der Firma M. Salomon in den 1930er Jahren müssen noch ermittelt und ausgewertet werden.
Quelle: Stadtarchiv Dresden, 2.3.9 Gewerbeamt A, Nr. S.0338.
Claudia Richert
Februar 2019
Manege frei – für den Zirkus „Corty-Althoff“ in Dresden-Löbtau. Eine Akte aus dem Stadtarchiv beschreibt den Bau des Zirkusgebäudes
Der Besuch einer Zirkusvorstellung um 1900 versprach für das Publikum das Erlebnis einer originellen, nicht alltäglichen Welt. Dresden war für die Zirkusdirektoren aus aller Welt ein beliebter Ort, da sie durch regen Zuschauerzuspruch gute Einnahmen erwarten konnten. So fanden im Februar des Jahres 1899 mehrere Vorstellungen des Zirkus „Corty-Althoff“ auf dem Crispi-Platz (heute Ebertplatz) in Löbtau statt. Der deutsche Zirkus „Corty-Althoff“ gehörte um die Jahrhundertwende zu den größten Zirkussen Europas. Pierre Althoff, der Zirkusdirektor, rühmte sich in einem Schreiben an den Gemeinderat von Löbtau, dass seine Künstlergesellschaft aus 150 Personen ersten Ranges bestand und er nicht weniger als 90 Pferde edelster Rassen mitführe. Pferdevorstellungen der höheren Reitkunst und Dressur gehörten ebenso zum Repertoire von „Corty-Althoff“ wie Akrobatik, Ballett und Pantomime.
Schon im Dezember 1897 hatte Pierre Althoff bei der Gemeindeverwaltung Löbtau eine Genehmigung zur Durchführung von Zirkusveranstaltungen für die Winterspielzeit 1898/99 beantragt. Im Blick hatte er die Freifläche des 1879 aufgelösten königlichen Holzhofes, der das gesamte Areal zwischen dem heutigen Ebertplatz, der Hirschfelder Straße und der Freiberger Straße umfasste. Den Bau eines hölzernen Zirkusgebäudes übernahm der Löbtauer Architekt und Baumeister Max Heinrich. Geplant war ein Interimsbau für die Veranstaltungen vom 1. Oktober 1898 bis zum 31. März 1899. Dies geht aus der Bauakte hervor, die sich im Stadtarchiv aus dem Bestand der Gemeindeverwaltung Löbtau erhalten hat. Das Dokument beschreibt neben der Bauausführung auch die Voraussetzungen des Gebäudes an Brandschutz und Sicherheit.
Um nach dem Vorstellungszeitraum das Zirkusgebäude nicht abreißen zu müssen, beantragte Max Heinrich noch 1899 die weitere Nutzung für Zirkusveranstaltungen. Dem Ansinnen des Architekten wurde von Seiten der Löbtauer Gemeinderäte stattgegeben und der Vertrag bis Juli 1900 verlängert. Danach wurde der Zirkus abgebaut. Dennoch blieb der Platz den Zirkusliebhabern erhalten, denn schon vor dem Abbau setzte sich Julius Herzog, Geschäftsführer des „Circus Sidoli“ aus Rumänien, für einen neuen Bau ein. Herzog kannte die örtlichen Gegebenheiten sehr gut, denn ein Jahr zuvor war er in derselben Position noch für den Zirkus „Corty-Althoff“ tätig gewesen. Julius Herzog und Cesar Sidoli planten anstelle einer Holzkonstruktion eine halbmassive Bauweise. Das Gebäude wurde dann im unteren Bereich mit Fachmauerwerk mit aufgesetztem Ständerwerk ausgeführt. Am 5. Januar 1901 begann die erste Vorstellung des rumänischen Staatszirkus. Wie die Akte berichtet, war an die Erteilung der Erlaubnis zur Abhaltung von Vorstellungen die Bedingung geknüpft, dass für den Gemeindevorstand und seinen Stellvertreter „eine Loge zu 4 Sitzen zur uneingeschränkten Benutzung für sich und deren Angehörige“ freizuhalten sei. Mit der Eingemeindung von Löbtau am 1. Januar 1903 endeten auch die Zirkusvorstellungen auf dem Crispiplatz. Die Spielstätte blieb noch bis März 1903 bewilligt und wurde danach endgültig geschlossen und abgetragen.
Quelle: Stadtarchiv Dresden, 8.25 Gemeindeverwaltung Löbtau, Nr. 2455, Bl. 14.
Marco Iwanzeck
Januar 2019
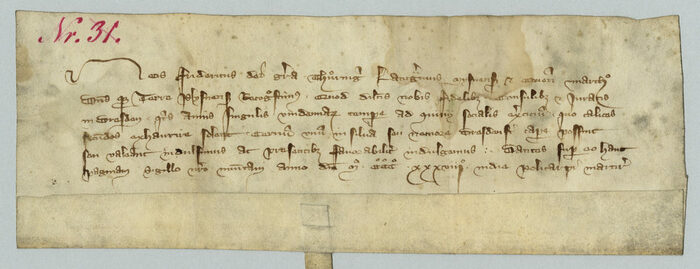
Vom „Hirsch-Schmauß“ der Dresdner Ratsherren - Ursprung und Werdegang einer sonderbaren Gunst
Vor rund 680 Jahren wurde dem Dresdner Rat durch den Landesherrn ein ganz besonderes Privileg gewährt, das mit einigen Einschränkungen bis zur Aufhebung im Jahr 1836 fast 500 Jahre Bestand hatte. Hiernach bestimmte Friedrich der Ernsthafte (1310-1349) am 26. Januar 1338 in einer Urkunde, dass seine „lieben treuen Ratsherren und Geschworenen“ in Dresden alle Jahre einen Hirsch im Dresdner Wald fangen dürften. Damit sollte das gemeinschaftliche Festmahl der Ratsherren in der Weinlesezeit kulinarisch veredelt werden, zu welchem sie offenbar „volle Becher zu leeren pflegten“. Allerdings scheint die delikate Gunst in der Folgezeit wieder in Vergessenheit geraten zu sein, denn in einem Dekret des Kurfürsten August von Sachsen (1526 – 1586) vom 31. August 1580, wodurch dem Rat jährlich zwei Stück Wild und 24 Hasen für die Abtretung von Jagdrechten zugesprochen wurden, fand sie keinerlei Erwähnung mehr.
In der Mitte des 17. Jahrhunderts machte dann der regierende Bürgermeister Christian Brehme (1613 – 1667), der zuvor von 1640 bis 1656 auch kurfürstlich-sächsischer Bibliothekar war, auf das Versäumnis nachdrücklich aufmerksam. Daraufhin bekräftigte Kurfürst Johann Georg II. (1613 – 1680) am Heiligabend des Jahres 1657 die „uhralte“ und seit einer „geraumen Zeit lang unterbliebene“ Schenkung schriftlich. Darüber hinaus erweiterte er sie dahingehend, dass die drei Bürgermeister Dresdens fortan jährlich je ein Stück Schwarzwild zu Weihnachten und einen „Osterhaasen“ vom Pirschmeister zusätzlich erhielten und sämtliches Wildbret gebührenfrei in „des regierenden Bürgermeisters Behausung alhier“ geliefert wurde. Alles in allem wurde der Rat somit mit einem Hirsch, zwei Stück Wild, drei Wildschweinen und 27 Hasen im Jahr beglückt. In einer überschwänglichen Huldigungsrede von Bürgermeister Valentin Scheffer (1592 – 1666) vom 24. September 1658 ließen die Räte den Landesherrn bei ihrem sogenannten „Hirsch-Schmauß“ für die vorzüglichen Gaben „von hertzen“ hochleben und ein Weinglas „in fröligkeit herumb gehen“. Allerdings kam es in der Anfangszeit häufiger zu Beschwerden auf Grund unvollständiger Lieferungen, während später fehlendes Wild kurzerhand anderweitig ersetzt oder in den Folgejahren nachgereicht wurde.
Ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts erfolgte meist nur noch eine bloße Übereignung der einzelnen Hirschteile an die Ratsherren, ungeachtet jeglicher gemeinschaftlichen Festivität. Dabei erhielten die Bürgermeister in der Regel den „Zimmel“, das begehrte Rückenstück des Hirsches. Letztendlich wurde das gesamte Wildbretdeputat im Jahr 1836 gegen Zahlung einer Entschädigungssumme von rund 1200 Talern aufgehoben, was etwa dem 25fachen Preis eines jährlichen Fleischkontingents entsprach. Dieser Entschädigung wurde auch vom Stadtrat zugestimmt - und darüber hinaus allen weiteren Ansprüchen „ausdrücklich und für immer“ entsagt.
Quelle: Stadtarchiv Dresden, 1.1, Ratsurkunden, Nr. 39.
Johannes Wendt
Archivalien des Monats aus dem Jahr 2018
Dezember 2018
Koffer-Kinos für Dresdner Schule
Mit der Kinoreformbewegung begann in Deutschland bereits Anfang des 20. Jahrhunderts eine zunehmend pädagogische Auseinandersetzung mit dem Medium Film. Bis dieses zu einem anerkannten und weit verbreiteten Bestandteil des Schulunterrichts wurde, vergingen allerdings noch mehrere Jahrzehnte. Die Schulfilmbewegung der Weimarer Republik erkannte zwar die didaktischen Vorteile des Lehrfilms, doch die praktische Umsetzung war schwierig. In Dresden besaßen Mitte der 20er Jahre nur wenige Schulen größere Räumlichkeiten, in denen Filme gezeigt werden konnten. Die Schülerinnen und Schüler aller anderen Schulen mussten die regelmäßigen Filmvorführungen in den Bezirkskinos besuchen. Diese dienten allerdings nur als Notbehelf, da durch den An- und Abmarsch der Kinder und Jugendlichen zu viel Unterrichtszeit verloren ging. Neben der Veranschaulichung von naturwissenschaftlichen Vorgängen und Erscheinungen, sollten die Filme einen positiven Einfluss auf die ethische, soziale, hygienische und künstlerische Erziehung der heranwachsenden Jugend nehmen. Gezeigt wurden beispielsweise Titel wie „Unter Wilden und wilden Tieren“, „Die deutsche Nordsee“ oder „Fern im Süd das schöne Spanien“.
Um allen Dresdner Schulen das Zeigen von Lehrfilmen im eigenen Haus zu ermöglichen ohne, dass dafür kostenintensive Umbaumaßnahmen vorgenommen werden mussten, wurde mit dem Haushaltsplan für das Jahr 1929 die Anschaffung von vier Koffer-Kinoapparaten der Zeiss Ikon A.G. Dresden bewilligt. Diese sollten von der Lichtbildhauptstelle ausgegeben werden und je nach Bedarf von Schule zu Schule wandern. Zur Erfüllung der feuerpolizeilichen Vorgaben, waren dafür in den Schulen nur kleinere bauliche Veränderungen nötig, die während der Sommerferien durchgeführt wurden.
Aus den umfangreichen Akten des Bestandes Schulmuseum im Stadtarchiv Dresden geht hervor, dass die Auswahl geeigneter Filme vor allem von der Lehrerschaft als problematisch angesehen wurde. Aus ihrer Sicht wirkten die Geschäftsinteressen der Filmindustrie, welche nur das Sensationsbedürfnis des Publikums sowie deren Hang zum Abenteuerlichen und Neugierde nach Sexuellem befriedigen wolle, den erzieherischen Zielen des Films entgegen. Es wurde daher empfohlen, dass jeder Schulbezirk in Zusammenarbeit mit der Sächsischen Landesbildstelle eine eigene Sammlung mit geprüften und an die schulischen Anforderungen angepassten Filmen anlegt, um sich vom Unternehmertum unabhängig zu machen. Bevor die Koffer-Kinos im Unterricht verwendet werden konnten, musste außerdem an jeder Schule mindestens ein Lehrer oder eine Lehrerin in einem zehntägigen Kurs der Sächsischen Landesbildstelle zum Filmvorführer ausgebildet werden.
Quelle:Stadtarchiv Dresden, 2.3.20 Schulmuseum, Nr. 414
Sophie Richter
November 2018
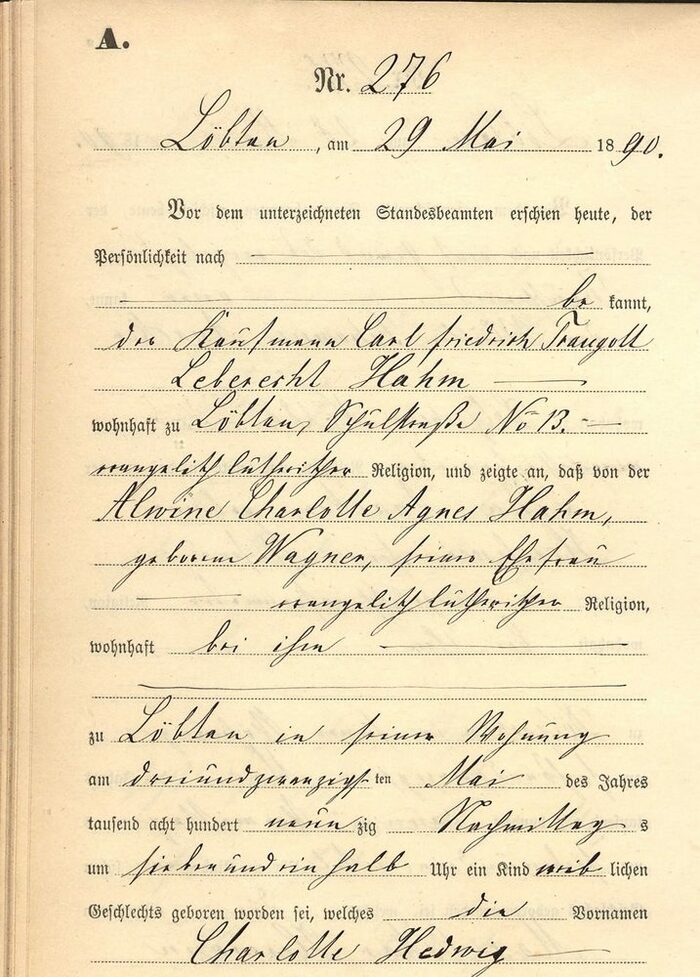
„Damen-Ball mit Windbeutel-Wettessen“
Der Berliner „Damenklub Violetta“ warb mit dieser Ankündigung für eine Samstagsveranstaltung im November der 1930er Jahre in einer Werbeanzeige. Darunter befand sich der dringliche Hinweis, dass „nur Damen Zutritt haben!“ Der Klub veranstaltete Tanzabende, Lesungen, Vorträge und gehörte der Homosexuellenvereinigung „Bund für Menschenrecht“ (BfM) an. Die Vorsitzende des Damenklubs Violetta war die am 23. Mai 1890 geborene Dresdnerin Charlotte Hedwig Hahm, genannt Lotte Hahm. Laut Dresdner Adressbuch lebte sie bis 1920 auf der Augsburger Straße 76 und war als Inhaberin einer Versandbuchhandlung tätig. Ab 1926 übernahm sie den Vorsitz des genannten Klubs, einer der größten und bekanntesten seiner Art in Berlin. Zu dem Zeitpunkt gehörte sie bereits zu den wichtigsten Vertreterinnen der homosexuellen und transsexuellen Organisation und Subkultur in der Weimarer Republik an. Ihr Markenzeichen war Kurzhaarschnitt, Hemd und Krawatte. Neben der Organisation zahlreicher Veranstaltungen schrieb sie als Chefredakteurin für die Zeitschrift „Die Freundin. Das ideale Freundschaftsblatt“. Im Jahre 1933 verbot das NS-Regime diese und weitere Zeitschriften für Homosexuelle. Die Verfolgung von Lotte Hahm während des Nationalsozialismus ist nicht ausreichend erforscht, ihre KZ-Internierung in Moringen lässt sich aber von 1935 bis 1938 nachweisen. Nach der Entlassung organisierte Lotte Hahm erneut Treffpunkte für lesbische Frauen und veranstaltete nach 1945 weiterhin Frauenabende. Sie gehörte zu denjenigen, die Ende der 1950er Jahre vergeblich versuchten, den „Bund für Menschrecht“ wieder ins Leben zu rufen. Im Jahre 1967 starb sie in Berlin.
Weitere Hinweise über ihr Leben in Dresden oder auch über vergleichbare Lokale, wie es sie in Berlin gab,lassen sich auf den ersten Blick in den Beständen des Stadtarchivs nur mühevoll rekonstruieren. Selbst die Forschungsliteratur über die lesbische Subkultur Dresdens in den 1920 und 1930er Jahren weist erhebliche Lücken auf. Aktuell wird in Dresden eine Ausstellung zur Geschichte von Lesben und Schwulen der 1980er und 1990er Jahre entwickelt. Das Büro der Gleichstellungsbeauftragten für Frau und Mann der Landeshauptstadt Dresden ist federführend damit betraut. Dabei werden Berichte von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen im Fokus stehen. Für das Zeitzeugenprojekt sucht das Büro der Gleichstellungsbeauftragten lesbische und schwule Personen, auch Trans- und Intersexuelle mit DDR- und BRD-Vergangenheit in Dresden. Sie können sich telefonisch unter 0351 488 2088 oder per E-Mail unter gleichstellungsbeauftragte@dresden.de melden.
Quelle: Stadtarchiv Dresden. 6.4.25 Standesamt Löbtau 1890, Nr. 276
Annemarie Niering
Oktober 2018
„Finnisch? Kann man Lernen!“
Finnland ist ein Land über das viele Vorurteile und Klischees kursieren. Es sei immer kalt, die Sprache sei die schwierigste der Welt und die Menschen introvertiert und wortkarg. Doch abgesehen von diesen Vorurteilen, ist weithin bekannt, dass das finnische Bildungssystem eines der Besten weltweit ist. Allein 2015 belegte Finnland den 5. Platz der weltweit geführten PISA-Studie. Den Anfang nahm diese Entwicklung in der ab Ende der 50er Jahre etablierten finnischen Bildungsreform. Das Archivale des Monats Oktober stammt aus dem Jahr 1959 - steht also zeitlich eingeordnet ganz am Anfang der besagten Reform. Hierbei handelt es sich um eine finnische Kinderfibel mit dem Titel "Meidän Lasten Aapinen", auf Deutsch "Unsere Kinderfibel", die mit das einzig finnischsprachige Werk im Bestand des Stadtarchivs markiert und somit allein schon der Herkunft und der Sprache wegen eine Besonderheit darstellt.
Die Fibel selbst stammt aus dem Schulbestand des Stadtarchivs. Ursprünglich wurde dieses Buch von Urho Somerkivi persönlich noch im Jahr des Erscheinens während eines Besuches in Dresden einem gewissen Fritz Lehmann gewidmet und signiert. Die Autoren des Schulbuches, Aukusti Salo und Urho Sommerkivi, waren beide maßgeblich an der Reform und Bildung des neuen Schulssystems beteiligt. Die Fibel ist reich illustriert und beinhaltet beginnend mit dem finnischen Alphabet, Kinderreime, Gedichte, Gebete und auch Volksmärchen (Kansasatut). Das Somerkivi sich auch für Folklore im eigenen Land einsetzte, erkennt man beispielsweise auch daran, dass sogar ein Gedicht vom national gefeierten Dichter Johann Ludvig Runeberg enthalten ist.
Die Zeichnungen stammen von Rudolf Koivu und Martta Wendelin. Beide waren zeitlebens populäre finnische Illustratoren von Kinder- und Märchenbüchern und noch heute wird jungen Künstlern solcher Werke der "Rudolf Koivu Preis" verliehen. In Finnland haben Fibeln (Aapinet) schon eine lange und für die Sprache sehr bedeutende Geschichte. Die älteste finnische Fibel wurde von Mikael Agricola, der als Finnischer Reformator und Begründer der Literatursprache in Finnland gilt, im Jahr 1543 unter dem Titel "Abckiria" veröffentlicht und ist damit gleichzeitig eines der ältesten Werke in finnischer Sprache. Diese war jedoch weniger für den schulischen Gebrauch, als vielmehr für die Nutzung durch literarisch bewanderte Priester gedacht. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts etablierten sich dann die Schulfibeln, wie wir sie heute noch zum Teil kennen. Nur zu Kriegszeiten, die die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts in Finnland prägten, waren sie aufgrund von Materialnot seltenes Gut. Umso populärer wurde dann die Fibel von Salo und Somerkivi am Ende der 50er, die mehrere Auflagen miterlebte und sofort mit der ersten Ausgabe "von der Schulbehörde genehmigt" wurde.
Quelle: Stadtarchiv Dresden, 13.48 Schulmuseum Nr. 141/3
Marc Eric Mitzscherling
September 2018
„Die edle Gärtner Kunst – Bringt Ehr und Gunst“ Lehrbrief eines Gärtnergesellen zu Dresden 1766
Grundlage für das Erlernen der Gärtnerkunst war eine dreijährige Ausbildungszeit. Diese absolvierte der Lehrling Johann Heinrich Bergmann, geboren in Markkleeberg bei Leipzig, beim Hof- und Orangengärtner Johann Christoph Berger im „Churfürstlich Herzoglichen Orangen Garten zu Dresden“ von 1763 bis 1766. Abschließend erhielt der Gärtner-Geselle, auch Adjunkt genannt, vom Lehrherrn einen Lehrbrief, mit dem er sich, gleich einem Handwerksgesellen, auf Wanderschaft begab. Der Lehrbrief von Bergmann beinhaltet allerdings kaum Aussagen über das erlernte Können und Wissen auf gärtnerischem Fachgebiet, sondern attestierte ihm vorrangig persönliche Tugenden wie gutes und gehorsames Verhalten, Gelehrsamkeit, Fleiß und Treue. Diese positive Einschätzung durch den Lehrmeister war dabei keineswegs optional sondern für eine nachfolgende Anstellung unerlässlich.
Dieser besondere Wert spiegelt sich auch in der aufwändigen Gestaltung des Lehrbriefes wider, der sich heute im umfangreichen Innungsurkundenbestand des Stadtarchivs Dresden befindet und im Monat September im Lesesaal zu sehen sein wird. Die Anfertigung erfolgte im Auftrag des Hofgärtners durch einen Schreiber und kostete eine Gebühr, die in etwa der Höhe eines Monatslohns entsprach. Neben der beachtlichen Größe von 58,5 x 37,5 cm zeigt das Pergament umlaufende Dekorationen mit grafischen und figürlichen Darstellungen, handbemalt mit Gold- und Farbverzierungen abgesetzt. Im Blickpunkt steht das Wappen des sächsischen Kurfürsten, in dessen Auftrag der Hofgärtner die Lehrlinge ausbildete. Ein wiederkehrendes Gestaltungsmotiv bilden die Füllhörner und Weinreben, die nicht nur als Ausdruck einer ertragreichen Obstzucht, sondern auch als Zeichen gelungener Gartenkunst verstanden werden können. Insbesondere die Abbildung der Weinernte am rechten Bildrand unterstreicht die Bedeutung des Hof- und Orangengärtners als Bindeglied zwischen nützlicher und schöner Gartenkunst.
Die Benennung des Herzoglichen Gartens als Arbeitsumfeld des Orangengärtners Berger führt dabei in die Geschichte des sächsischen Gartenbaus zurück. 1575 erhielt der spätere Kurfürst Christian I. von Kaiser Maximilian II. vier Pomeranzenbäume aus Prag als persönliches Geschenk und widmete sich seither verstärkt der Beförderung der Obst- und Gemüsezucht, insbesondere der Zitrusgewächse. In diesem Sinne ließ Christian I. 1591 für seine Gemahlin Sophie, die Kurfürstin und Herzogin von Sachsen, einen Lustgarten an der heutigen Ostra-Allee mit einem festen „Pomeranzenhaus“ errichten. Einen beträchtlichen Bedeutungszuwachs erhielt der Herzogin Garten 1728 als Winterquartier für die Pflanzen der Zwinger-Orangerie, die auf Betreiben des Kurfürsten Friedrich August I. von Sachsen ab 1709 errichtet worden war.
Quelle: Stadtarchiv Dresden, 11.1 Innungsurkunden, Nr. 1252
Sylvia Drebinger
August 2018
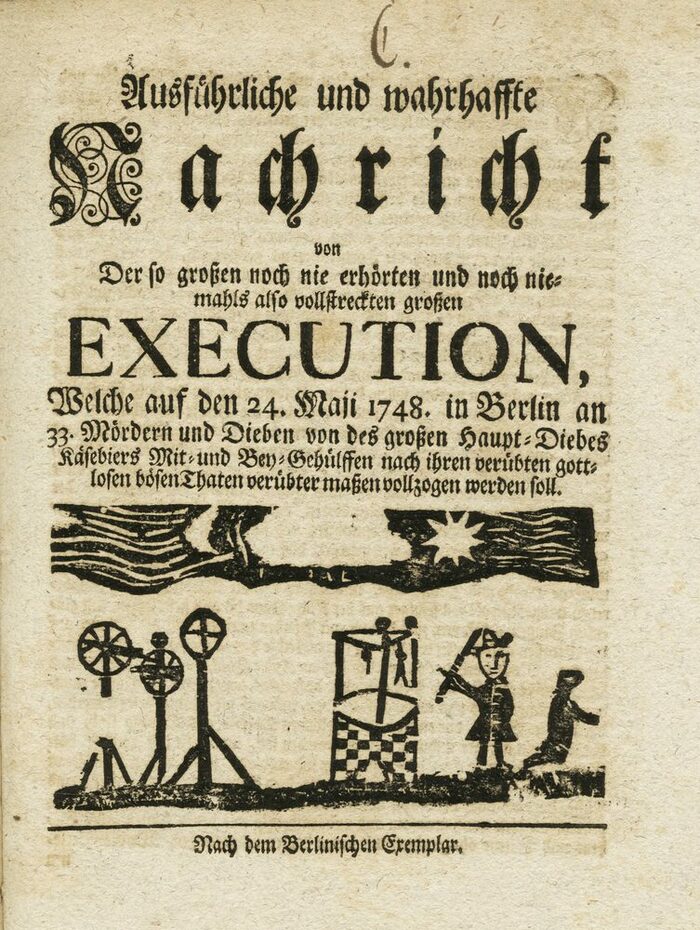
Von Räubern, Flugschriften und Fakenews. Nachrichtenverbreitung in Dresden im 18. Jahrhundert
Nachrichten sind in der modernen Welt sekundenschnell abrufbar und mit der heutigen Medientechnik jederzeit verfügbar. Im 18. Jahrhundert hingegen verbreiteten sich Nachrichten durch Druckerzeugnisse oder Mundpropaganda langsamer und gingen oft nicht über einen lokalen Umkreis hinaus. Das im Stadtarchiv ausgestellte Archivale des Monats August bildet hierbei eine Ausnahme. Das Flugblatt aus dem Jahr 1748 gehört zu einer Sammlung von Flugschriften, die über die Missetaten eines in Berlin gefangengenommen Anführers einer Räuberbande namens Gottfried Käsebier berichten. Seine Taten werden darin detailliert beschrieben und reichen von Diebstahl, Betrug bis hin zu Mord. Zwei Drucke kündigen sogar die Hinrichtung von Käsebier und seiner Diebesbande an.
Tatsächlich wurde 1748 Christian Andreas Käsebier im Brandenburgischen festgenommen. Trotz unterschiedlicher Vornamen handelt es sich um ein und dieselbe Person. Die in Dresden kursierenden Flugschriften scheinen jedoch ein eher fantastisches als realistisches Bild darzustellen. Danach soll Käsebier etliche Morde und Diebstähle gestanden haben. Angesichts der Schwere der dargestellten Delikte erscheint seine Bestrafung mit Festungshaft als ein sehr mildes Urteil, so dass es unwahrscheinlich ist, dass er all die Taten begangen hat. Die Flugschrift überzeichnet bewusst das Bild seiner Verbrechen, um den Gefangenen als Bösewicht darzustellen und gleichzeitig als Warnung für Nachahmer zu dienen. Die vier Seiten umfassende Schrift wurde von zwei Frauen auf der Elbbrücke in Dresden und von Georg Gottlieb Fuchs am Pirnaischen Tor verbreitet. Dies rief den Stadtrat auf den Plan, denn die Schriften wurden ohne vorherige Zensur und Genehmigung gedruckt und ohne Erlaubnis in der Stadt verkauft. Der Wachtmeister Hennig wurde beauftragt alle Verkäuferinnen und Verkäufer zum Verhör zu bringen. Aus den Befragungen ergab sich, dass der Dresdner Buchdrucker Johann Christoph Krause die Schriften verfielfältigt hatte. Im Verhör gab Krause an, dass er nicht Autor der Schriften war, sondern lediglich die Flugschrift nachdruckte, die zu diesem Zeitpunkt schon in Berlin kursierte. Nach seinen Gründen befragt, antwortete der Buchdrucker, dass er zur Zeit keine Arbeit hätte und nicht wusste, wovon er Leben sollte. Die anonymen Autoren und Buchdrucker der Flugschriften konnten mit dieser Art der Geschichtenerzählung durchaus florierende Geschäfte machen. Der Stadtrat berichtete auch dem sächsischen Kurfürsten Friedrich August II. von den Vorfällen in der Stadt. Friedrich August II. wies den Stadtrat an, Krause nicht nur ernstlich zu verwarnen, sondern auch eine Strafe von zehn Talern aufzuerlegen.
Quelle: Stadtarchiv Dresden, 2.1.2 Ratsarchiv B.XVII.88, Bl. 8.
Marco Iwanzeck
Juli 2018
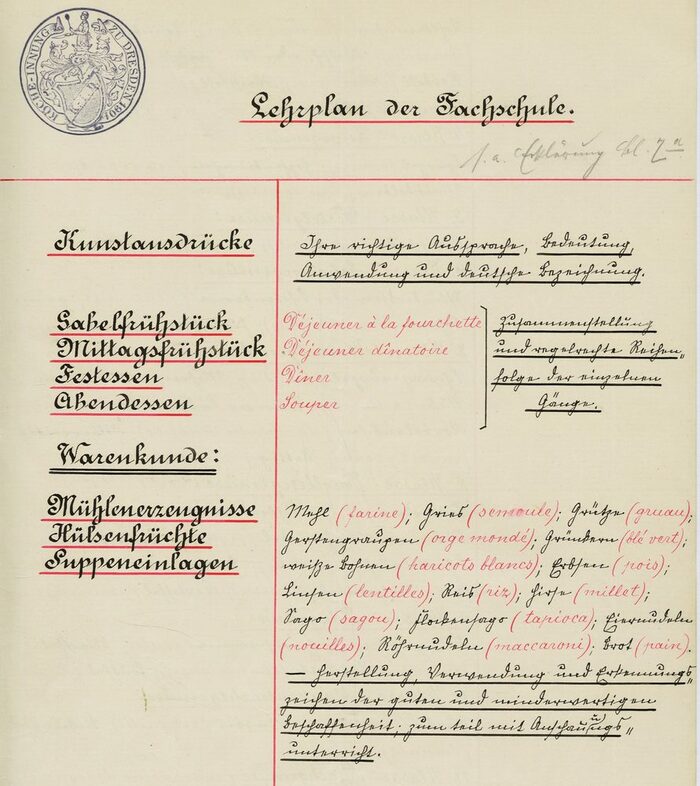
„Ein Plädoyer für eine klare Sprachregelung in der Kochkunst“
Anfang des 20. Jahrhunderts engagierte sich der vor 90 Jahren in Dresden verstorbene Ernst Clemens Lößnitzer (1852) für eine „klare Sprachregelung in der Kochkunst“. Ernst Lößnitzer, Koch und Obermeister der „Köche-Innung“ veröffentlichte dazu zwei bedeutende Publikationen, zum einen das „Große Deutsche Kochbuch der feinen und bürgerlichen Küche“ (1906) und zum anderen das „Verdeutschungswörterbuch. Ein Plädoyer für eine klare Sprachregelung in der Kochkunst“ (1911). Dieses Wissen lehrte er ab 1907 an der „Fachschule der Köche-Innung zu Dresden“ und setzte sich für die Fachausbildung von angehenden Köchinnen und Köchen ein.
Die Archivale des Monats dokumentiert ausschnittsweise den handschriftlichen Lehrplan zum Thema „Kunstausdrücke“ und „Warenkunde“ aus dem Jahre 1907. Den auf der linken Seite verzeichneten deutschen Begriffen setzte Lößnitzer die französische Übersetzung gegenüber. Die Übersetzung vom Französischen in die deutsche Sprache verdeutlicht nicht nur die Lehrweise, sondern auch den Zeitgeist. Deutschlands Köche beanspruchten für sich im späten Kaiserreich eine ambitionierte kulinarische Kunst auf Augenhöhe mit Frankreich und ganz Europa. Nach Beginn des Ersten Weltkriegs hielt die patriotische Begeisterung Einzug in nahezu sämtliche Lebensbereiche wie auch in das Gastgewerbe und es kam zu einer regelrechten „Verdeutschungskampagne“ von französischen Begriffen. Unzählige Firmen und Geschäfte änderten nach Kriegsbeginn ihren Namen. Ob aus patriotischer Überzeugung oder aus Angst der Betreiber/-innen vor Ausgrenzung und Umsatzverlust hießen die einstigen „Boutiquen“ nun „Modegeschäfte“ und das „Cafe de Paris“ verwandelte sich in ein „Kaffeehaus Germania“.
Seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert besuchten die Dresdner Kochlehrlinge parallel zur Ausbildung in der Küche ihres Lehrherrn bereits die „Fach- und Fortbildungsschule des Vereins Dresdner Gastwirte“. Dort wurden sie in Deutsch, Lesen, Schreiben sowie in zeitgenössischer Schönschrift und Buchführung unterrichtet. Nach Ansicht der „Köche-Innung“, die sich im Jahre 1901 konstituierte, war dieser Unterricht richtig, ihrer Meinung nach kam aber das spezifische Fachwissen zu kurz. Denn die Lehrlinge wurden berufsbezogen nur „in Men[u]kunde, Warenkunde sowie fachgewerblichem Rechnen“ unterrichtet. Das entsprach nicht den Anforderungen „die an den angehenden Koch gestellt und in jedem Haus, das Anspruch auf eine bessere Küche erhebt, verlangt werden“ könne. Dementsprechend gründete die „Köche-Innung“ eine eigene Fachschule, die durch städtische Unterstützung Räume auf der Marschallstraße 21 in der 10. Volksschule für den Unterricht erhielt.
Im Schuljahr 1921/22 besuchten insgesamt 18 Schüler den Unterricht. Der Lehrplan beinhaltete im Mai 1921 die Themen „Kunstausdrücke. Ihre richtige Aussprache, deutsche Verzeichnung und Anwendung“ sowie die „Entwicklungsgeschichte der Kochkunst. Geschmack und Feinschmeckerei. Ernährung und Verdauung.“ Dort unterrichteten Ernst Lößnitzer oder eine Vertretung in wöchentlich zwei aufeinander folgenden Stunden. Am 1. Mai 1935 wurde die Fachschule der Köche-Innung aus politischen und finanziellen Gründen aufgelöst. Das Berufliche Schulzentrum für Gastgewerbe auf der Ehrlichstraße 1 erhielt im Jahr 2008 den Ehrenname „Ernst Lößnitzer“ verliehen.
Quelle: Stadtarchiv Dresden, 2.3.20 Schulamt, Sect. I.; Cap. X, Nr. 156, Bl. 3.
Annemarie Niering
Juni 2018
Die Gasbeleuchtungsanstalt am Zwinger - öffentliche Straßenbeleuchtung vor 190 Jahren
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts sorgten Laternen für eine eher dürftige Beleuchtung der Dresdner Innenstadt. Angeregt durch die in London eingeführte Straßenbeleuchtung mit Steinkohlengas schlug der Geheime Rat dem sächsischen König die Erstellung eines Gutachtens über die Anwendbarkeit dieser Beleuchtungsart in Dresden vor. Nach dessen Befürwortung wurde das für die Straßenbeleuchtung zuständige Stadtpolizei-Kollegium im Juni 1816 beauftragt, sich mit Professor Lampadius in Freiberg in Verbindung zu setzen, der eine englische Abhandlung zu diesem Thema bearbeitet und übersetzt hatte. Das Stadtpolizei-Kollegium war eine Behörde, der Staatsbeamten und Ratsmitglieder angehörten.
Nach Abwägung der Vor- und Nachteile befürworteten die Landesregierung und das Stadtpolizei-Kollegium die Einführung der Gasbeleuchtung in Dresden. Im Dezember 1820 genehmigte König Friedrich August I. von Sachsen (1750-1827) den Versuch, die Plätze um das Theater, die Hofkirche und das Schloss mit Gaslicht beleuchten zu lassen. Der Gasorgelbauer Uthe und Inspektor Blochmann vom Königlich-Mathematisch-Physikalischen Salon hatten sich bereits seit einigen Jahren mit dieser Beleuchtungsart beschäftigt und ihre Werkstätten damit ausgestattet. Nach einem Test ihrer Apparaturen wurde Blochmann 1825 mit der Ausführung des Projekts betraut.
Rudolf Sigismund Blochmann (1784-1871) war ein Pfarrerssohn aus Reichstädt bei Dippoldiswalde. Er hatte eine Ausbildung am Mathamatisch-Mechanischen Institut in München bei George von Reichenbach absolviert und seit 1809 eine mechanische Werkstatt bei Fraunhofer betrieben, wo er auch Beleuchtungsversuche mit Gas duchrchführte. Seine Pläne für die Gasbereitungsanstalt am nordöstlichen Ende des Zwingerwalls wurden von König Anton (1755-1836) am 14. Juni 1827 bestätigt, nachdem sein Bruder König Friedrich August I. verstorben war. Am 27. April 1828 wurde der Betrieb aufgenommen und der Schlossplatz beleuchtet. Anlass waren die Feierlichkeiten zur Geburt des Thronfolgers, der vier Tage zuvor das Licht der Welt erblickt hatte. Bis Jahresende folgten weitere Straßen und Plätze, wie die Schloßgasse, der Altmarkt und die Augustusstraße. 1833 ging das Gaswerk in städtisches Eigentum über. Rudolf Siegismund Blochmann wurde die Leitung übertragen. Seine Planungen aus dem Jahr 1831 für die Erweiterung der Gasbereitungsanstalt sind im Stadtarchiv überliefert. Blochmann übernahm auch die Leitung des 1839 erbauten neuen Gaswerkes an der Stiftsstraße.
Quelle: Der Sammler für Geschichte und Alterthum, Kunst und Natur im Elbthale, Dresden 1837, Stadtarchiv Dresden, 18 Bibliothek, Nr. Z.188.4a, S.25
Christine Stade
Mai 2018
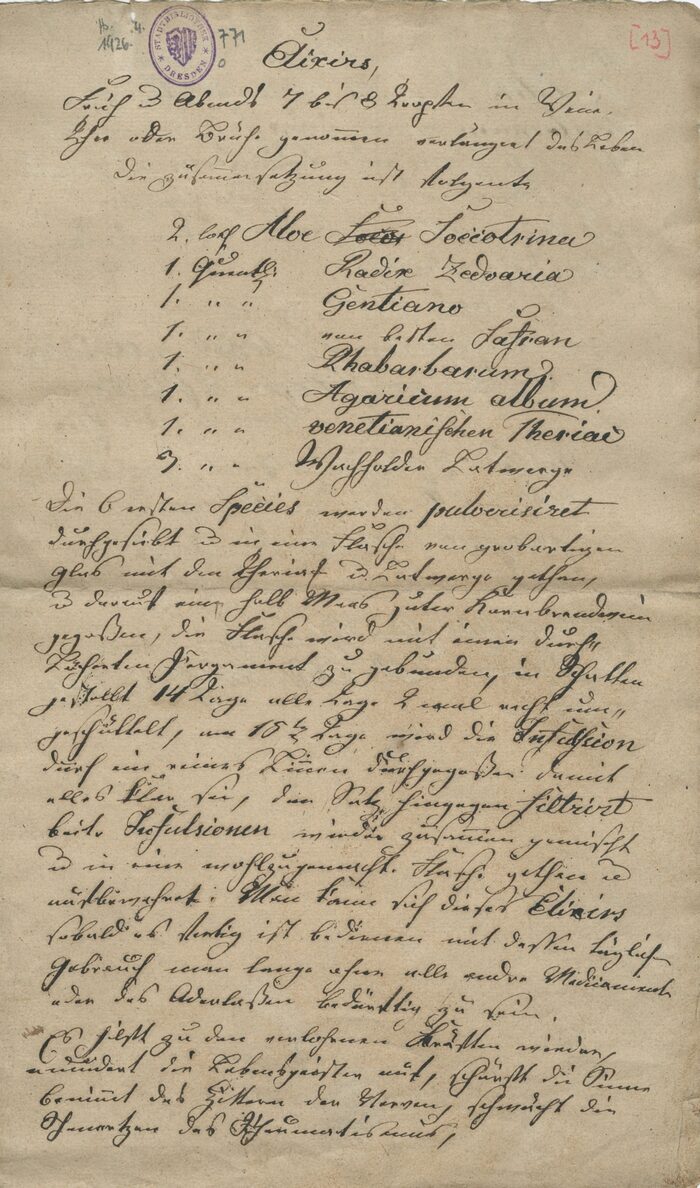
„... ein paar Tropfen in den hohlen Zahn ...“ Über eine alte Rezeptur für die Herstellung eines besonderen Heilmittels
Ein Elixier zur Verlängerung des Lebens ist gewiss einer der sehnsüchtigsten Wünsche seit Menschengedenken. Im Stadtarchiv Dresden befindet sich tatsächlich ein vermeintliches Rezept hierfür. Es stammt aus dem Nachlass der Familien Schmidtgen und Werner und wurde vermutlich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts handschriftlich verfasst. Neben dem Rezept für das Elixier finden sich in dem im Jahre 1926 übernommenen Bestand weitere Anleitungen für die Herstellung verschiedener Heilmittel, etwa für einen Tee zur Blutreinigung, für ein „blaues Kalg Wasser“ zur Behandlung von Augenentzündungen und für Brandsalben. Nur drei Tropfen des Lebenselixiers am Morgen und sieben bis acht Tropfen am Abend mit Wein, Tee oder Brühe eingenommen, sollen das Leben auf wundersame Weise verlängern. Insgesamt werden acht besondere Zutaten zur Herstellung benötigt. Dazu gehört Aloe socotrina, eine Pflanzenart aus der Gattung der Aloen, von der zwei Lot, also etwa zwei volle Löffel, erforderlich sind. Außerdem wird ein Quentchen, das heißt etwa ein Viertel oder Fünftel eines Lots, von der Zitwerwurzel gebraucht, die auch als Weiße Curcuma bekannt ist und aus der Familie der Ingwergewächse entstammt. Des Weiteren ist die gleiche Menge Enzian, „bester“ Safran, Rhabarber, Lärchenschwamm sowie Wachholder Latwerge notwendig, letzteres ist eine eingedickte Saft-Honig-Zubereitung. Und nicht zuletzt muss venezianischer Theriak bereitgehalten werden, der bereits in der Antike ein Antidot zur Behandlung von Vergiftungen bezeichnete. Diese Kräutermixtur galt im Mittelalter sogar als universelles Wunderheilmittel, wobei der Theriak aus Venedig sensationelle Berümtheit erlangte. Zur Herstellung des Elixiers müssen zunächst die trockenen Zutaten pulverisiert, gesiebt und zusammen mit der Latwerge, dem Theriak und einem halben Maß eines guten Kornbranntweines in eine Flasche „von grobartigem Glas“ gefüllt werden. Diese wird mit einem durchlöcherten Pergament verschlossen, vierzehn Tage in den Schatten gestellt und täglich zweimal geschüttelt. Danach ist das Substrat durch ein reines Leinentuch zu filtrieren, wieder zu vermischen und in eine „wohlzugemachte“ Flasche zu füllen. Durch den täglichen Gebrauch soll das fertige Elixier angeblich Kräfte mobilisieren und die Lebensgeister wecken, außerdem die Sinne schärfen sowie Nervenzittern und Rheumaschmerzen lindern.
Im Übrigen sollen „alle andre Medicamente“ durch die Einnahme des Heilmittels für lange Zeit obsolet werden. Zur spezifischen Behandlung von Übelkeit sei ein Esslöffel, bei Koliken seien drei Esslöffel mit der vierfachen Menge an Branntwein einzunehmen. Bei Zahnschmerzen wiederum sollten einfach ein paar Tropfen auf Baumwolle aufgetragen und diese in den „hohlen Zahn“ gedrückt werden. Das Mittel würde ohne Schmerzen wirken, allerdings dürfe man dazu kein Obst oder Salat essen und keine Milch trinken.
Achtung: Die hier vorgestellte Rezeptur ist lediglich eine Wiedergabe der archivischen Überlieferung. Es handelt sich nicht um eine Herstellungs- und Gebrauchsanweisung. Die Anwendung erfolgt auf eigene Gefahr, eine Haftung ist ausgeschlossen.
Quelle: Stadtarchiv Dresden, 16.2.25, Familiennachlass Schmidtgen und Werner, Nr. 13.
Johannes Wendt
April 2018
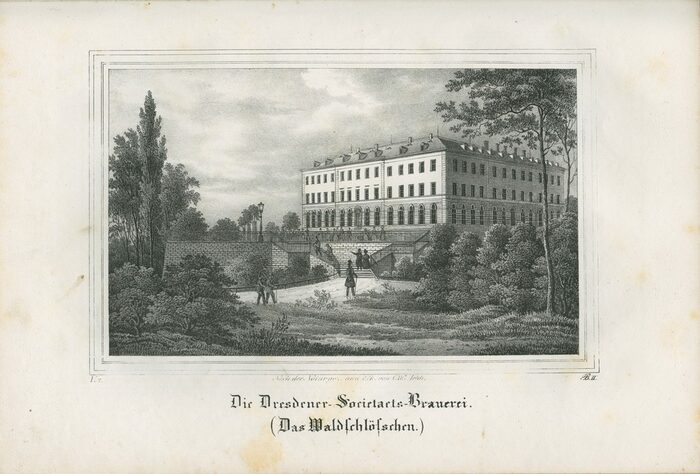
Wasser und Bier für das Waldschlösschen
Vor 180 Jahren feierten die Dresdner die Eröffnung der Societätsbrauerei am Waldschlösschen. Am 26. März 1838 strömten Tausende Gäste in das Brauhaus, um Biere nach bayrischer Brauart zu kosten. Glaubt man den Überlieferungen wurden am ersten Tag circa 600 Liter Bier ausgeschenkt. Doch nicht nur der Bierausschank lockte die Besucher zum Waldschlössen. Von der Terrasse hatten die Gäste einen herrlichen Blick über das Elbtal und auf die Silhouette der Stadt. Die Zeitgenossen verfielen auch beim Anblick der Societätsbrauerei ins Schwärmen, denn „es leuchtet des flandrischen Bierkönigs Gambrinus stattliches Schloß dort am rechten Elbufer gar einladend ins Auge der Gegenwart.“
Doch bevor das erste Bier am Waldschlösschen gebraut werden konnte, mussten infrastrukturelle Maßnahmen geschaffen werden, um das Brauen überhaupt zu ermöglichen. Neben dem Bau von Lagerkellern und einer Mälzerei war die Versorgung mit frischem Trinkwasser eine Grundvoraussetzung. Laut einer Ratsakte aus dem Stadtarchiv wandte sich der Besitzer des Grundstücks, Stadtrat Heinrich Wilhelm Rachel, 1837 mit einem entsprechenden Gesuch an das Königliche Forstamt Dresden. Rachel hatte das Grundstück am Waldschlösschen im Auftrag der Gesellschafter erworben und wurde nach Eröffnung in das Direktorium der Societätsbrauerei berufen. In seinem Schreiben bat Rachel „um käufliche Ueberlassung von Röhrwasser von der Neustädter Wasserleitung“ für den Bedarf der Brauerei, was ihm von den Behörden gegen Auflagen bestätigt wurde.
Die Wasserröhren vom Waldschlösschen zur Neustädter Hauptleitung in Länge von 1.322 Ellen (circa 700 Meter) durch Fischhaus-Revier hatte die Aktiengesellschaft auf eigene Kosten zu bauen und zwar mit „möglichster Schonung des Waldes und auf dem zu bestimmenden Tracte.“ Dafür versprach die Königliche Wasser-Kommission etwa sieben Liter in einer Minute zu liefern. Die funktionierende Wasserleitung sorgte jedenfalls dafür, dass am Tag der Eröffnung kein Besucher durstig nach Hause gehen musste.
Quelle: Stadtarchiv Dresden, 18 Z.176; in Saxonia: Museum für Sächsische Vaterlandskunde - Dresden: Pietzsch, 1835-1841. Bd. 5. 1841. Nr. 1. 1841. S. 8.
Marco Iwanzeck
März 2018
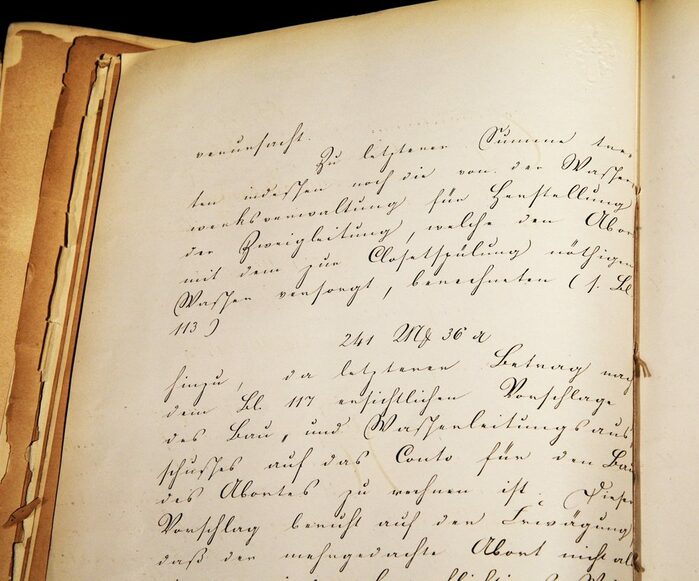
„Das erste öffentliche Wasserklosett in Dresden“
Genau vor 140 Jahren, am 1. März 1878, berichtete Oberbürgermeister Stübel den Stadtverordneten von der Errichtung des ersten Wasserklosetts in Dresden, das zugleich auch die erste Bedürfnisanstalt für Frauen war. Das Wasser dafür lieferte das erste Dresdner Wasserwerk Saloppe. Die „Abortanlage für Damen“ befand sich in den äußeren Bürgerwiesen-Anlagen, nahe dem Zoologischen Garten, auf der Parkstraße 10b.
Bereits im Jahre 1873 hatten Stadtrat und Stadtverordnete aus sanitären Gründen den Bau eines öffentlichen Aborts für Frauen in Betracht gezogen. Allerdings lagen für die Planung und zu den Kosten einer solchen Anlage kaum Erfahrungen vor, so dass das Vorhaben nicht weiter verfolgt wurde. Der „Bezirks-Verein der Wilsdruffer Vorstadt und der Friedrichstadt“ griff das Thema auf und stellte am 12. Februar 1876 beim Stadtrat folgende Anfrage: „Der geehrte Rath wolle erwägen, ob nicht für Frauen die Errichtung von Bedürfnisanstalten angezeigt scheine […].“ Daraufhin erfolgte im März 1876 eine Anfrage beim Rat der Stadt Leipzig, wo bereits 1875 auf dem Fleischerplatz eine Bedürfnisanstalt für Frauen entstanden war. Vor allem ging es um Informationen über Konstruktion und Standort, aber auch um Erfahrungen, die, „besonders hinsichtlich der Frequenz der Benutzung und in sittlicher Beziehung, mit denselben gemacht worden sind“.
Mit den gewonnenen Erkenntnissen erarbeitete das Stadtbauamt eine „Vorlage zur Errichtung einer Bedürfnisanstalt für Frauen in Dresden“, die am 12. April 1876 von Oberbürgermeister Pfotenhauer an die Stadtverordneten zur Genehmigung überwiesen wurde. Wie in Leipzig sollte sich hier der Standort keinesfalls im Stadtzentrum befinden, sondern außerhalb, in der Bürgerwiese. Nach zahlreichen Debatten und Umplanungen konnte im Mai 1877 mit dem Bau des ersten Wasserklosetts in Dresden begonnen werden. Man entschied die Anlage durchgehend zu öffnen und eine Wärterin anzustellen. Die Einnahmen von der Abortbenutzung sollten dieser als Honorar für ihre Dienste überlassen und ein Pachtgeld nicht erhoben werden. Der Bauplan sah vor, im Mittelbau den Abort für Frauen und eine Wärterinnen-Wohnung unterzubringen. Da man bei der isolierten Lage befürchtete, „dass die Anstalt leicht der Schauplatz allerhand, insbesondere sich gegen die Frauenwelt richteten versteckten Unfuges werden könnte“, wurde das Pissoir für Männer zur besseren Überwachung neben der Wärterinnenstube platziert. Der Stadtrat erachtete die Anlage als zweckmäßig und ästhetisch.
Mehr zum Thema können Sie noch bis zum 30. März 2018 im Stadtarchiv Dresden in der Ausstellung „Verborgene Geschichte(n) aus dem Stadtarchiv“ erfahren.
Quelle: Stadtarchiv Dresden, 3.1 Stadtverordnetenakten, Nr. P.39, Bd. I, Bl. 45b
Carola Schauer
Februar 2018
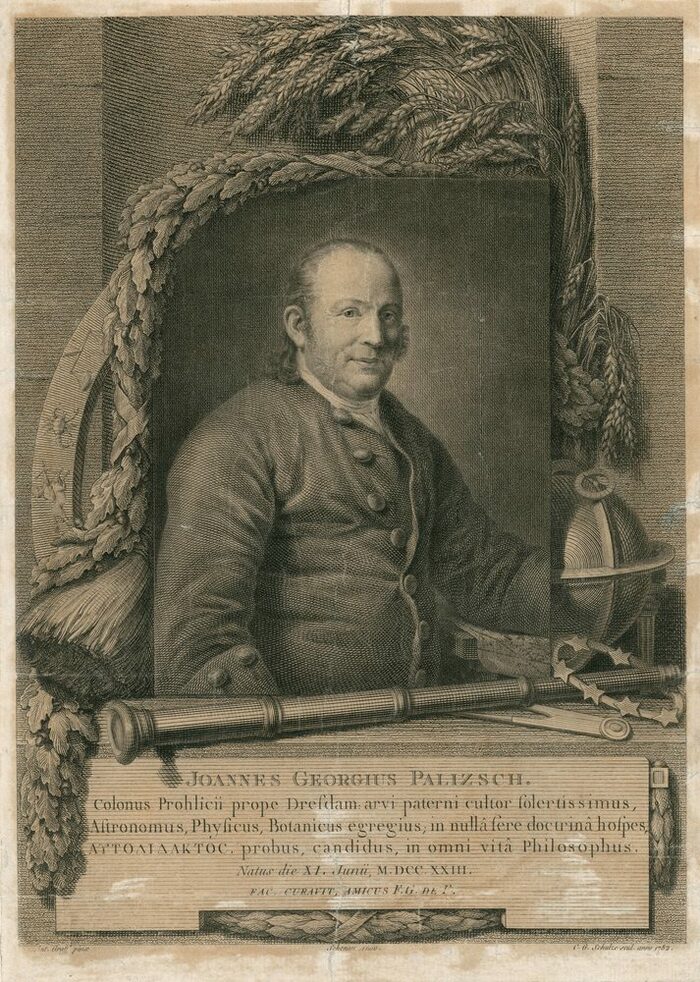
Johann Georg Palitzsch (1723 - 1788) und der Halley’sche Komet
Vor 230 Jahren, am 21. Februar 1788, starb der gelehrte Prohliser Gutsbesitzer Johann Georg Palitzsch. Schon seit frühester Jugend faszinierten ihn astronomische und naturwissenschaftliche Entdeckungen. Deshalb nutzte er trotz anstrengendem Ausbildungs- und Arbeitsalltag auf dem väterlichen Bauerngut die wenigen freien Stunden für autodidaktische Studien der Astronomie, Physik, Botanik und anderer Naturwissenschaften. Am 16. August 1744 übernahm Palitzsch das Gut von seiner Mutter und dem Stiefvater für eine Kaufsumme von 3100 Gulden. In dem Erbkaufvertrag im Gerichtsbuch des Maternihospitalamtes Dresden sind alle Gebäude, Haustiere und der Hausrat detaillert registriert. Endlich unabhängig, konnte Palitzsch seine Forschungen weiter vorantreiben und sogar einen botanischen Garten auf dem Gut anlegen. Mit dem ebenfalls als Autodidakt bekannten Astronomen Christian Gärtner aus Tolkewitz betrieb er intensive Himmelsbeobachtungen mit dem Fernrohr, die er akribisch aufzeichnete. Durch Gärtner wurde Palitzsch mit Georg Gottlieb Haubold, dem Inspektor des mathematisch- physikalischen Salons in Dresden, bekannt. Dieser bot ihm die Möglichkeit, die dort vorhandenen wissenschaftlichen Abhandlungen und Gerätschaften zu nutzen. Bekanntheit erlangte der Prohliser Landwirt 1758 durch den erstmaligen Nachweis von Süßwasserpolypen in sächsischen Gewässern. Eine weitere Entdeckung im Dezember 1758 verschaffte ihm Anerkennung in astronomischen Fachkreisen. Im Dresdner Anzeiger Nr. 2/1759 heißt es: „Als ich nach meiner mühsamen Gewohnheit, alles was in der Physic vorfällt, so viel möglich zu betrachten, und gegen den Himmels-Begebenheiten aufmerksam zu seyn, den 25. jetzigen Dezemb[er] Monaths abends um 6 Uhr mit meinem 8-füßigen Tubo die Fix-Sterne durchgienge, um zu sehen wie wohl sich der ietzt sichtbare Stern des Wallfisches darstelle, als auch ob sich nicht der seit langer Zeit verkündigte und sehnlich erwünschte Komet nähere oder zeige; so wurde mir das unbeschreibliche Vergnügen zu theil, nicht weit von diesem wunderbaren Wallfisch-Sterne, im Sternbild der Fische ... einen sonst niemahlen dort wahrgenommenen neblichten Stern, zu entdecken.“ Palitzsch hatte als Erster den Kometen entdeckt, dessen Wiedererscheinen Halley für das Jahr 1758 vorausgesagt hatte. Eine genaue Beschreibung liefert der Dresdner Anzeiger Nr. 7 von 1759. Weitere astronomische und wissenschaftliche Beobachtungen sowie seine Erfolge als Landwirt brachten Palitzsch 1770 die Ehrenmitgliedschaft der „Leipziger ökonomischen Societät“ ein. Das von dem Bildhauer Ernst Wilhelm Knieling geschaffene Denkmal setzte die Gemeinde Prohlis ihrem „Sterngucker“ im Jahr 1877. Das Palitzsch-Museum in Dresden-Prohlis wurde 1988 begründet.
Quelle: Stadtarchiv Dresden, 15.13. Ortsarchiv Leubnitz-Neuostra, Nr. 141
Christine Stade
Januar 2018
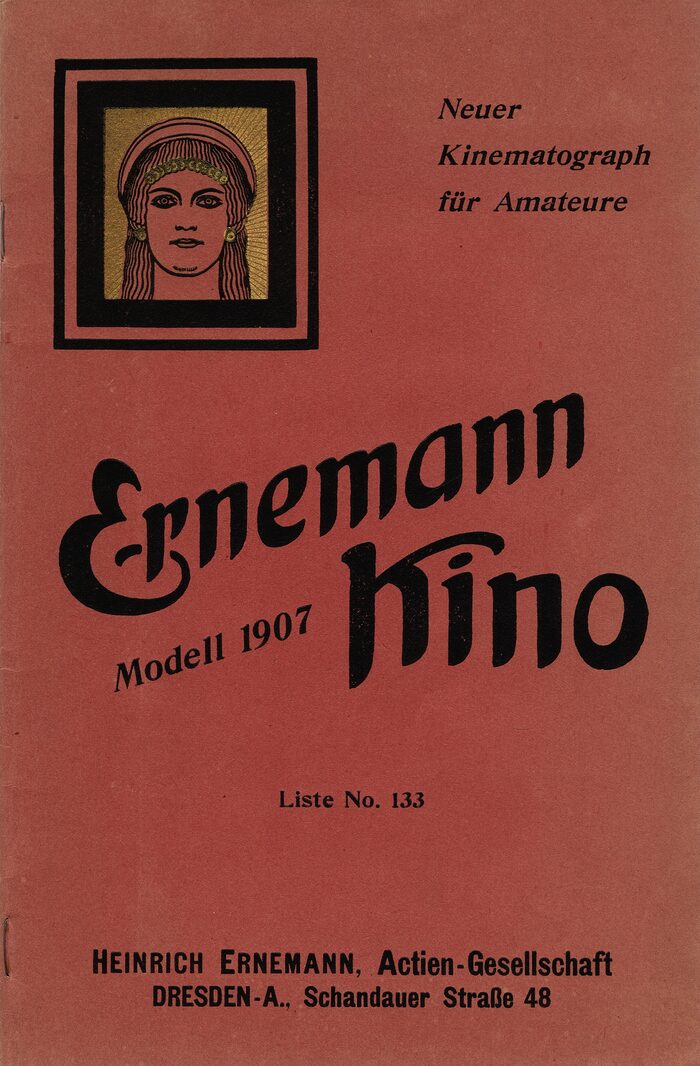
Heinrich Ernemann - Ein Pionier der Kameraproduktion
Gehen wir heute Abend ins Kino? Eine oft gestellte Frage. Der Begriff „Kino“ leitet sich von Kinematograph her? Schon sind wir mitten drin in der Geschichte des Kamerabaus in Dresden und eines seiner Pioniere, des Kaufmanns Heinrich Ernemann (1850-1928). Heinrich Ernemann war ein Visionär, der zur richtigen Zeit die Potentiale der Fotografie und von bewegten Bildern erkannte.
Seit 1876 war Ernemann als Kaufmann in Dresden tätig. Am 5. November 1889 meldete er ein Gewerbe zu-sammen mit Wilhelm Franz Matthias zur Fabrikation fotografischer Apparate in der Güterbahnhofstraße 10 an. Am 9. April 1890 verlegten die beiden ihre Firma „Dresdner photographische Apparate-Fabrik“ in ein Hinterhaus in der Pirnaischen Straße 50. Am 26. März 1895 zog sich Franz Wilhelm Matthias aus der Firma zurück. Ernemann war nun der alleinige Inhaber der Firma. Im Jahr 1897 wurde der Grundstein für das bekannte Firmengelände an der Schandauer Straße gelegt. Ernemann wollte von Zulieferern möglichst unabhängig sein. Er baute eine eigene mechanische Werkstatt auf und 1907 kam die optische Abteilung hinzu. Er setze vor allem auf Qualität und auf Spezialkameras für Profis. Dresden wurde zum Hauptstandort der fotografischen Industrie Deutschlands. Die Ernemann-Werke, seit Mai 1899 eine Aktiengesellschaft, hatten daran großen Anteil. Die Erzeugnisse wurden von Ernemann als Markenartikel deklariert, um sie zu schützen und deren Nachbau zu erschweren. Eine der bekannten Schutzmarken war die Lichtgöttin, nach dem vom Maler Hans Unger (1872-1936) für die Fassade des Ernemann-Baus in der Schandauer Straße entworfenem Glasmosaik.
Anfang 1903 brachte Ernemann seinen ersten Kinematografen heraus und taufte ihn auf den Namen „Kino“. In einer Werbebroschüre von 1907 wird die Kinematographie als wichtiges Erziehungs-, Bildungs- und Unterhaltungsmittel für die Allgemeinheit dargestellt. Auch für die passenden Filme wurde gleich gesorgt, es gab humoristische Szenen, historische Bilder, Städtebilder und Straßenszenen, sowie Szenen aus dem Kinderleben. Das „Kino“ erfreute sich fortan im In- und Ausland großer Beliebtheit.
Quelle: Stadtarchiv Dresden, 17.2.1 Drucksammlung, A 272/I.
Gisela Hoppe
Archivalien des Monats aus dem Jahr 2017
Dezember 2017
„Schilling & Graebner“ und Bau der „Alten Zionskirche“
Die Architekten Schilling & Graebner hinterließen in Dresden mit dem Rathaus Pieschen, der Christuskirche Strehlen oder den Ergänzungsbauten für Lahmanns Sanatorium Bleibendes. Rudolf Schilling und Julius Graebner lernten sich bei ihrem Architekturstudium am Dresdner Polytechnikum kennen. Sie gründeten im Jahr 1889 gemeinsam in Dresden das Architekturbüro „Schilling & Graebner“. Nach dem Tod von Julius Graebner im Jahr 1917 trat dessen Sohn Erwin Graebner in die Firma ein. Rudolf Schilling starb 1933. Im Jahr 1947 wurde das Architekturbüro „Schilling & Graebner“ geschlossen. Zahlreiche Dokumente sind im Stadtarchiv zu beiden Architekten überliefert, so auch eine mehrseitige Abhandlung Graebners vom 2. April 1907 über den neuen Entwurf der Zionskirche.
Der Maschinenfabrikant Johann Hampel setzte die Stadt Dresden kurz vor seinem Tod im Jahr 1896 testamentarisch zur Universalerbin seines Vermögens ein, unter der Bedingung, dass aus den Mitteln der Erbschaft eine evangelisch-lutherische Kirche im Gebiet der See- oder Südvorstadt errichtet wird. Dazu schrieb die Stadt am 18. April 1901 einen Wettbewerb zur Erbauung einer evangelisch-lutherischen Kirche aus. Schilling & Graebner gewannen den 2. Preis und erhielten den Auftrag für das Bauprojekt. Am 27. Juli 1908 mit dem Bau begonnen werden. Am 29. September 1912 fand die Weihe der „Zionskirche“ (wie sie seit der Grundsteinlegung am 5. November 1901 genannt wurde) statt.
Bei den Luftangriffen auf Dresden im Februar 1945 wurde die Kirche schwer getroffen und brannte bis auf die Umfassungsmauern aus. Sie wurde später mit einem provisorischen Dach gesichert. Im Tausch gegen das Areal für die Neue Zionskirche erhielt die Stadt Dresden die Kirchenruine, welche sie seit 1966 als Lapidarium nutzt.
Die Entwurfszeichnungen zeigt das Stadtarchiv Dresden im Rahmen der Sonderausstellung „Verborgene Geschichte(n) aus dem Stadtarchiv“, die am 4. Dezember 2017 mit einer Vernissage eröffnet wurde.
Quelle: Stadtarchiv Dresden, 10 Bau- und Grundstücksakten, Nr. 14172, Blatt 6.
Anett Hillert
November 2017

Ein neues Siegel für die Gemeinde „Weißer Hirsch“
Als ein „stucke holzces an der heyde, das sich anhebet an der brucken in dem Mortgrunde und gehet uff die straße biis an den Luczehobil unde gehet dann herabe von dem Luczehobil zcwischen der gemeyne von der Bele eynen grasewegk biis in den Rochewiczer grund […]“ wird das östlich von Dresden gelegene Gebiet, der heutige Stadtteil Weißer Hirsch, im 15. Jahrhundert beschrieben. Doch woher stammt dieser untypische Stadtteilname?
Im Jahr 1685 kaufte der kurfürstliche Kapellmeister Christoph Bernhard(i) den Weinberg südlich der Verbindungsstraße nach Bautzen und ließ dort die Schenke mit dem Namen „Zum Weißen Hirsch“ errichten. Woher Bernhard(i) die Inspiration zu dieser Namensgebung nahm, lässt sich nicht eindeutig klären. Eine Vermutung ist aber, da es sich bei der Dresdner Heide um ein beliebtes Jagdgebiet handelte, dass sich Bernhard(i) der Sage des Heiligen Hubertus erinnerte. Der Sage nach begegnete dieser bei der Jagd einem Weißen Hirsch mit einem leuchtenden Kreuz zwischen dem Geweih. Der „Weiße Hirsch“, der sowohl für die Schenke, als auch für die Gemeinde namensgebend war, zierte bis 1921 auch das Siegel der Gemeindeverwaltung. Es zeigte einen geteilten Wappenschild mit einem Hirschkopf darüber.
Am 13.03.1894 veröffentlichte das Ministerium des Innern einen Beschluss, der die Verwendung wappenähnlicher Siegel von Landgemeinden untersagte. Diesen Beschluss nahm die Königliche Amtshauptmannschaft Dresden/Neustadt zum Anlass, das Siegel der Gemeinde „Weißer Hirsch“ überprüfen und ändern zu lassen. Eine entsprechende Aufforderung seitens der Amtshauptmannschaft ging 1902 beim Gemeinderat „Weißer Hirsch“ ein. Nach einer umfangreichen Überprüfung des Siegels wurde der Gemeinde „Weißer Hirsch“ am 7. September 1904 die weitere Verwendung dieses Siegels, in der bis dahin bestehenden Form, untersagt und es erging die Aufforderung ein neues Gemeindesiegel zu entwerfen.
Entwürfe verschiedenster Künstler gingen beim Gemeinderat ein. Ihre Motive sind im Stadtarchiv Dresden heute noch überliefert. Den Zuschlag für das neue Gemeindesiegel aber erhielt der Berliner Professor Hildebrandt. Das Siegel zeigt einen nach rechts blickenden gezungten weißen Hirsch. Das neue Gemeindesiegel wurde am 18. März 1905 in Gebrauch genommen.
Quelle: Stadtarchiv Dresden, 8.58 Gemeindeverwaltung Weißer Hirsch, Nr. 75.
Marco Kramer
Oktober 2017
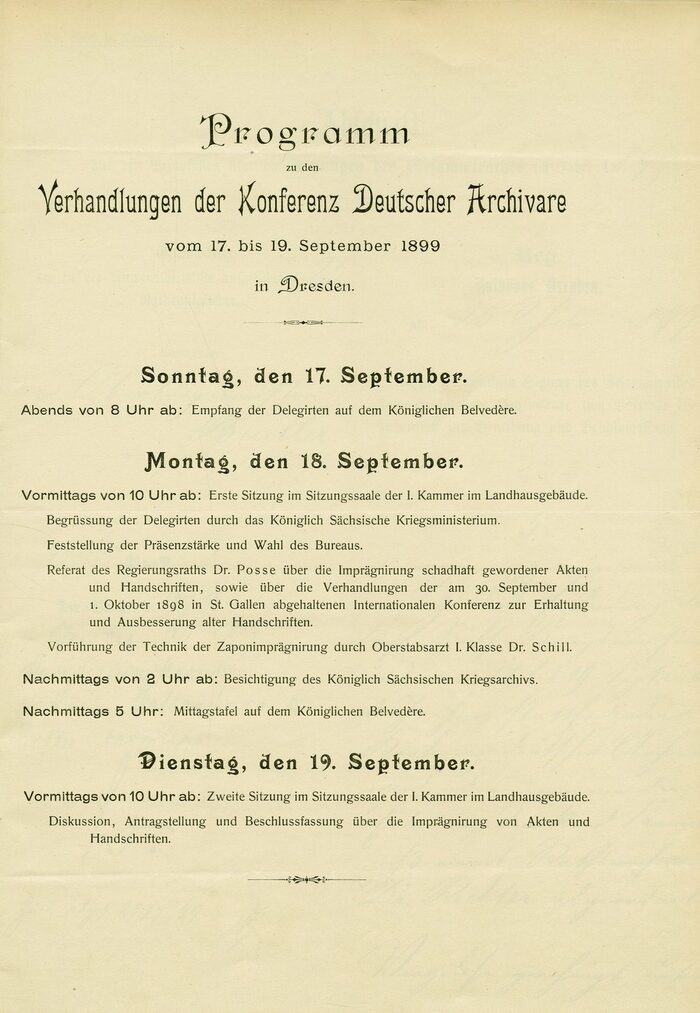
Das Zapon-Verfahren. Eine Dresdner Erfindung zur Erhaltung von Archivalien?
Es gehört zu den Hauptaufgaben von Archivaren, die ihnen anvertrauten Schätze zu bewahren und zu erhalten. Wertvolle Handschriften, Urkunden, Bücher, Akten, Landkarten und Fotos waren immer wieder durch schlechte Lagerungsbedingungen, Umwelteinflüsse, knappe Kassen oder durch Schädlinge, die Papier, Pergament und Leder zerstören, bedroht. Die Suche nach einem Schutzmittel zum Erhalt von wertvollen Archivalien wurde am Ende des 19. Jahrhunderts zu einer internationalen Angelegenheit.
1898 hatte eine internationale Konferenz zur Erhaltung und Restaurierung alter Handschriften in St. Gallen stattgefunden. Die Königlich-Sächsische Regierung entsandte den Oberregierungsrat Dr. Otto Adalbert Posse (1847-1921) nach St. Gallen. Er hatte dort die Aufmerksamkeit auf das von Oberstabsarzt Dr. Ernst Georg Schill (1852-1925) aus Dresden erfundene Zapon-Verfahren gelenkt. Der Name “Zapon“ ist willkürlich gewählt. Es basiert auf der Grundlage von Nitrocellulose, die bereits 1848 entdeckt worden war (Zaponlack ist ein Nitrolack). 1899 trafen sich Archivare aus allen Teilen Deutschlands in Dresden, um über das Verfahren zu beraten. Dr. Posse ging in seiner Rede vom 18. September 1899 vor den Teilnehmern der Dresdner Konferenz auf die Ergebnisse der Konferenz in St. Gallen ein und stellte die verschiedenen in St. Gallen besprochenen Konservierungsmethoden vor.
Dort wurde die Empfehlung für das Schillsche Imprägnierungsverfahren von weiteren Prüfungen und Studien abhängig gemacht. Oberstabsarzt Dr. Schill hatte das Verfahren um 1892 für das Militär erfunden, um Generalstabskarten im Freien und namentlich bei Regenwetter benutzen zu können. Neben dem militärischen Zweck sollten mit dem Zapon-Verfahren neue Wege archivarischer Konservierungsmöglichkeiten gegangen werden.
Da noch Langzeitstudien fehlten, beschlossen manche teilnehmenden Archive, Versuche mit der Zapon-Imprägnierung durchzuführen. Das Verfahren konnte sich jedoch nicht für die Konservierung von historischen Dokumenten durchsetzen. Allerdings gibt es Zaponlack, welcher als Oxidationschutz für Metalle gebräuchlich ist, noch heute.
Gisela Hoppe
September 2017
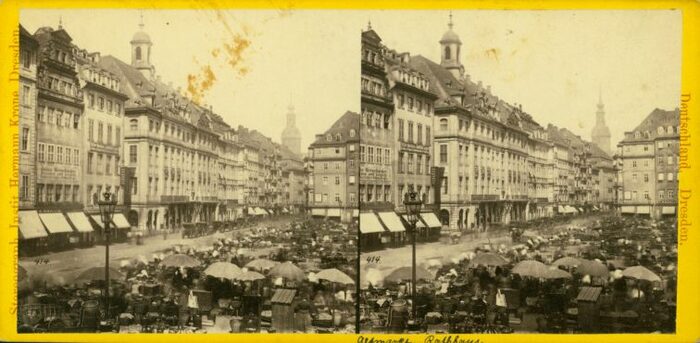
Stereofotografie von Hermann Krone.
Im Jahre 2011 konnte das Stadtarchiv Dresden mit Hilfe der Drewag ein Konvolut historischer Dresdner Foto-grafien erwerben. Dabei handelt es sich um eine Vielzahl von Stadtansichten, insbesondere um Stereofotografien aus den Jahren zwischen 1860 und 1890. In Sachsen war es vor allem der gebürtige Breslauer Hermann Krone (1827 - 1916), der schon in den 1850er Jahren mit der Stereofotografie experimentierte und in der Folge auch eine Vielzahl von Stereokartons zum Verkauf herstellte. In dem 1998 erschienenen Sammelband zum „Photopionier Hermann Krone“ beschreibt Dieter Lorenz die Besonderheit der Stereofotografie folgendermaßen: „Das räumliche Sehen des Menschen bewirken seine beiden Augen.
Wegen deren Abstandes von etwa 60 bis 70 Millimeter entwerfen sie auf ihren Netzhäuten zwei geringfügig voneinander verschiedene Bilder, die im Gehirn zu einem räumlichen Bild verschmolzen werden. Die Stereofotografie vollzieht dies nach und fügt so der „flachen“ Fotografie die dritte Dimension hinzu.“ Auf der abgebildeten Archivalie ist das lebhafte Markttreiben mit den Händlern und Käufern auf dem Altmarkt um 1865 dokumentiert. Am linken Bildrand befindet sich das Dresdner Rathaus, hervorgehoben durch den Dachreiter mit Uhr. Im Hintergrund zeichnet sich mittig die Silhouette des Hausmannsturms ab. An den Nachfolgebauten der 1950er Jahre ist der Standort des Altstädter Rathauses durch das Dachtürmchen markiert (heute: Eingang Altmarkt Galerie). Carl Hermann Julius Krone hatte es sich bereits in seinem Gesuch für das Bürgerrecht als Hauptaufgabe gestellt, die Stadt „mit besten Absichten“ zu dokumentieren. Seit 1849 verweilte Krone zeitweise in der Kunstakademie Dresden. Nach Erlangung des Bürgerrechts eröffnete er 1853 sein erstes Fotostudio auf Marienstraße 30 in der Nähe des Postplatzes. Das Stadtarchiv verwahrt neben den erworbenen Stereofotografien auch die Gewerbeakte von Carl Hermann Julius Krone mit Geschäftsbriefen, Rechnungen und anderen Gewerbeunterlagen.
Annemarie Niering
August 2017
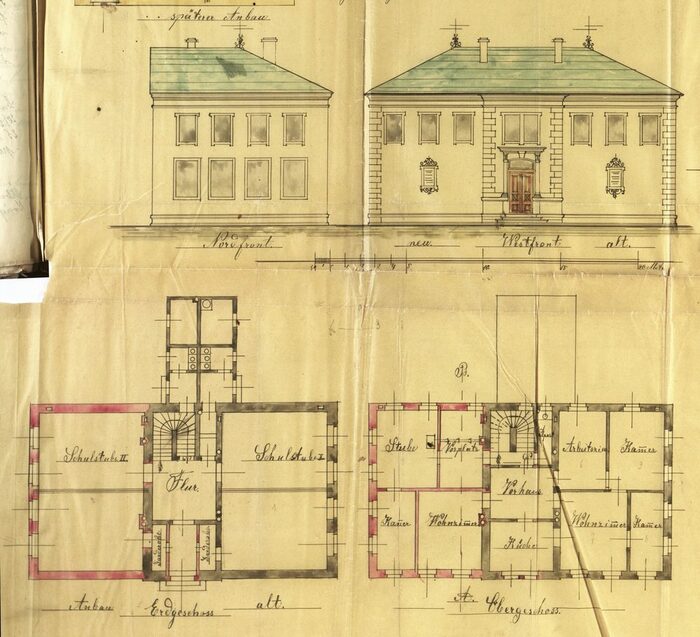
Eine Schule für Rochwitz
Schulneubauten stehen momentan in Dresden ganz oben auf der Agenda. Nicht nur Sanierungen der bestehenden Schulen sind notwendig, sondern mit steigenden Schülerzahlen muss neuer Raum zum Lernen geschaffen werden. So geschieht es gegenwärtig auch mit der 61. Grundschule „Heinrich Schütz“ in Rochwitz, die einen modernen Ersatzneubau an alter Stelle bekommt. Dafür musste allerdings das in die Jahre gekommene Gebäude weichen. Das alte Schulhaus wurde 1882 gebaut. Der Vorstoß der Gemeinde Rochwitz am Ende des 19. Jahrhunderts eine eigene Schule zu bauen, begründete sich mit der wachsenden Bevölkerung im Ort. Bis dahin gingen die Schülerinnen und Schüler der Gemeinde über den als Kirchweg ausgebauten Feldweg nach Bühlau zum Lernen. Der Wunsch des Ortvorstehers eine eigene Schulgemeinde zu gründen, fußte auch darauf, den Kindern den längeren Weg nach Bühlau zu ersparen. Demzufolge beantragte der Gemeindevorsteher Carl Eisold im Jahr 1882 bei der königlichen Schulinspektion die „Ausschulung“ der Rochwitzer Schülerinnen und Schüler aus der Schulgemeinde Bühlau. Die Genehmigung wurde von der Behörde erteilt. Im Stadtarchiv Dresden sind Akten erhalten, die den Weg der Rochwitzer zur eigenen Schulgemeinde dokumentieren. Für die zwei gebildeten Klassen aus 67 Schülerinnen und Schülern stand ein großer geteilter Klassenraum im Erdgeschoß zur Verfügung. Im Obergeschoss des neuen Gebäudes bezog der Lehrer seine Wohnung.
Schon 1893 wurde die zehn Jahre zuvor neu gebaute Schule zu klein, sodass eine Erweiterung des Schulhauses nötig wurde. In den zwei Klassen gab es jeweils 67 und 61 Schüler. Der Lehrer mahnte an, dass wegen Überfüllung das Schulziel in allen Fächern gefährdet sei. Realisiert wurde der Anbau an das bestehende Gebäude bis zum Jahr 1899. Mit der Eingemeindung des Ortes Rochwitz nach Dresden im Jahre 1921 wurde auch die Schulgemeinde in das städtische Schulsystem integriert. Gegenwärtigen Planungen zufolge bleibt von der alten Schule der prägnante Sandsteingiebel mit Turmuhr erhalten. Als neuer Standort wird der Platz gegenüber des neuen Schulgebäudes favorisiert.
Marco Iwanzeck
Juli 2017
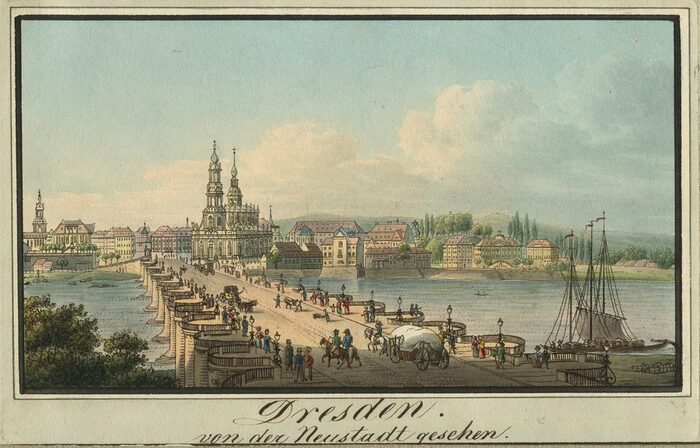
Heinrich Wilhelm Calberla - Begründer der ersten sächsischen Zuckerfabrik
Landesherrliche Privilegien für das Zuckersieden wurden bereits seit dem 16. Jahrhundert in Dresden, insbesondere für Apotheker, erteilt. Heinrich Wilhelm Calberla (1774-1836) begründete das erste größere Unternehmen dieser Art in Sachsen. Als Mitglied des Bürgerausschusses für die Abtragung der Dresdner Festungsanlagen fand er schnell einen passenden Bauplatz am Zwingerwall. Auf seinem neu erworbenen Grundstück an der ehemaligen Bastei Sol, nahe dem Feuerwerksplatz, ließ Calberla im Jahr 1817 den Grundstein für die Zuckersiederei legen. Die Ratsakte „Die von dem hiesigen Drechslermeister Heinrich Wilhelm Calberla anzulegende Zuckerfabrik und dessen Gesuch um Accis-Fixaktion seiner Zuckerfabrikate ...“ zeugt von den Problemen bei der Etablierung des Unternehmens und von den Auseinandersetzungen mit der Dresdner Kaufmannschaft. Diese sahen in der Fabrik eine Gefahr für ihre eigenen Handelsrechte und Einkünfte. Laut dem am 26. März 1821 erteilten Privileg zum uneingeschränkten Verkauf von raffiniertem Zucker, Kandis und Sirup durfte Calberla deshalb seine Zuckerwaren nicht im Einzelhandel, sondern nur ab einer Menge von einem viertel Zentner verkaufen.
Heinrich Wilhelm Calberla war ein vielseitiger Unternehmer. Er stammte aus Braunschweig, lernte das Handwerk eines Drechslers und erwarb im Jahr 1800 das Dresdner Bürgerrecht. Als Kunstdrechsler fertigte er Tabakpfeifen, Brettspielfiguren und andere Erzeugnisse aus Horn und Schafbein an. Darüber hinaus erhielt Calberla eine Gaststättenkonzession und interessierte sich für die Dampfschifffahrt. Er glaubte daran, dass das Befahren der Elbe mit Schleppdampfern möglich ist, um den Rohzucker für die Zuckersiederei und andere Waren schneller und günstiger transportieren zu können. Deshalb ließ er in Krippen nach seinen Vorstellungen ein Schleppschiff erbauen, das 1833 nach Hamburg fuhr. Mit einer dort eingebauten englischen Dampfmaschine und Waren kehrte das Dampfschiff im Winter 1834/1835 wohlbehalten nach Dresden zurück. Leider verunglückte es auf seiner nächsten Fahrt. Ungeachtet dessen zählt Calberla zu den Pionieren der Dampfschifffahrt auf der Elbe. (siehe Dresdner Geschichtsblätter, Nr. 3,1916, S. 164-174). Nach seinem Tod im Jahr 1836 führte der Sohn Gustav Moritz Calberla die Zuckerfabrik nur wenige Jahre weiter, nutzte die Räumlichkeiten aber auch für Wohnungen und anderen Zwecke. Aufgrund der guten Lage am Altstädter Elbufer, neben dem Italienischen Dörfchen und dem inzwischen erbauten Opernhaus, wurden die ehemaligen Fabrikgebäude nach dem Verkauf 1853 zu einem Hotel umgebaut. Das bekannte und renommierte Dresdner Hotel Bellevue wurde 1945 zerstört.
Christine Stade
Juni 2017
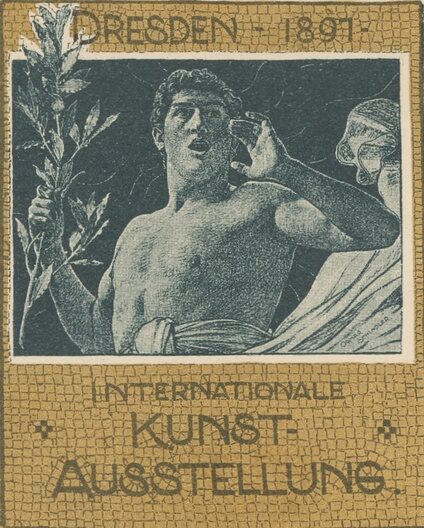
Die erste Internationale Kunstausstellung 1897 in Dresden
Am Sonnabend, den 1. Mai 1897 eröffnete im städtischen Ausstellungsgebäude auf der Stübelallee die 1. Internationale Kunstausstellung in Dresden. Nebst dem sächsischen König und Mitgliedern des Königshauses, waren die wichtigsten Entscheidungsträger der Stadt und Bildungseinrichtungen zugegen. Künstler und Künstlerinnen aus 12 verschiedenen Staaten waren eingeladen, ihre etwa 1300 Werksarbeiten, vorrangig Ölgemälde, Aquarelle, Zeichnungen, sowie Plastiken und architektonische Beiträge, in den 22 Räumen des Ausstellungspalastes zur Schau zu stellen. Eine Internationale Kunstausstellung hatte die Stadt Dresden - so suggerierten die Dresdner Nachrichten - bitter nötig, denn sie drohte durch ihre Reminiszenzen an eine längst überholte Ästhetik, kulturell in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden. Deutsche Kunst, den internationalen Künstlern gegenüberzustellen, war ein Kerngedanke der Ausstellungsmacher. Die Schau wechselte zwischen vaterländischen Motiven und der Rezeption eines neuen Kunstverständnisses. Dieser Widerspruch bildete sich auch in den gewählten Objekten ab, die entweder eine neue vereinfachte Formen- und Farbsprache oder die bisher praktizierten naturalistische Anleihen aus Historismus und Spätromantik dokumentierten. Nicht immer erschienen die ungewohnten Ansätze auf Begeisterung zu stoßen. „Wir wollen hoffen, die capricitöse Nüchternheit, die sie athmen, die gekünstelte Einfachheit der Materialien [...] die gemüthlose Dekandence der Formen macht nicht Schule bei uns“ - sinnierte beispielsweise ein Journalist der Dresdner Nachrichten. Im Verlaufe der nächsten Monate etablierte sich die Ausstellung, trotz aller Skepsis, zu einem gesellschaftlichen Ereignis. Dem Ausstellungsgremium gelang es durch zahlreiche wechselnde Angebote, wie Ermäßigungen, festlichen Rahmenveranstaltungen, Vorträge, Verlosungen oder gar den Einsatz von Sonderzügen der Staatsbahn nach Dresden, reges Interesse auch bei denjenigen der Kunst bisher ferner stehenden Menschen zu wecken. So sahen sich an Sonntagen durchschnittlich etwa 1500 bis 6000 Menschen die Kunstwerke an. Die gelungene Melange aus Aufklärung, ästhetischer Erneuerung, sowie finanziellem Erfolg durch den Verkauf vieler Werke an Sammler, strahlte auf zukünftige Ausstellungen aus und bescherte Dresden in Ansätzen wieder den Ruf einer maßgebenden Kunststadt.
Claudia Pawlowitsch
Mai 2017
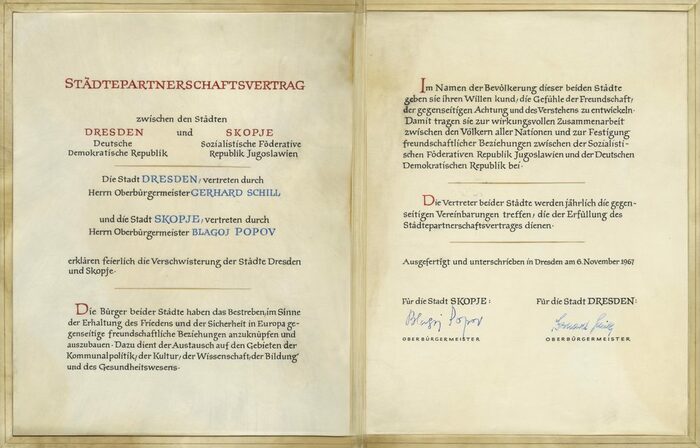
Über die „Verschwisterung“ von Dresden und Skopje. 50 Jahre Städtepartnerschaft mit der mazedonischen Hauptstadt
Am 6. November 1967 wurde mit der Unterzeichnung des Städtepartnerschaftsvertrages durch die Ober-bürgermeister Gerhard Schill und Blagoj Popov feierlich die „Verschwisterung“ von Dresden und Skopje erklärt und damit offiziell die Absicht verkündet, „für Frieden und Sicherheit in Europa gegenseitige freundschaftliche Beziehungen anzuknüpfen und auszubauen“ und „Gefühle der Freundschaft, der gegenseitigen Achtung und des Verstehens“ zu entwickeln. Hierfür war insbesondere ein Wissens- und Erfahrungsaustausch in den Bereichen Kommunalpolitik, Kultur, Wissenschaft, Bildung und Gesundheitswesen vorgesehen, wobei für die konkrete Umsetzung jährlich detaillierte Vereinbarungen getroffen werden sollten. Die mazedonische Hauptstadt wurde am 26. Juli 1963 von einem verheerenden Erdbeben heimgesucht, bei dem mehr als 1000 Menschen ihr Leben und etwa drei Viertel der Bevölkerung ihr Obdach verloren. Binnen Minuten war der Großteil der Gebäude in der Stadt zerstört oder schwer beschädigt.
Die weltweite Anteilnahme nach der Katastrophe war außerordentlich: mehr als 75 Länder leisteten internationale Hilfe in den folgenden Jahren, darunter auch die DDR. In Dresden befand sich damals das Generalsekretariat des Deut-schen Roten Kreuzes der DDR. Als im November 1965 eine Delegation aus Skopje in Dresden war, um dem Präsidium des Deutschen Roten Kreuzes eine besondere Auszeichnung für die humanitäre Hilfe zu überreichen, regten die Gäste auch den Abschluss eines Freundschaftsvertrages an. Nach der Zustimmung durch die Vertreter beider Städte in der ersten Jahreshälfte 1966 wurden dann im Oktober die Verhandlungen für die Vorbereitung der Städtepartnerschaft geführt. Der Programmentwurf aus Skopje sah etwa den Erfahrungsaustausch im Bereich der Verkehrs- und Grünflächenplanung, Kooperationsprojekte kultureller Institutionen und Schulen sowie den Austausch von Bild- und Filmmaterial zur Förderung des Tourismus vor. Im Juni 1967 wurden Artikel der beiden Oberbürgermeister in der Presse veröffentlicht, die den Einwohnerschaften einige Eindrücke über die zukünftige Partnerstadt vermitteln sollten. Nach Abschluss der Vertragsunterzeichnung im November 1967 verwies Blagoj Popov noch einmal auf die Erfahrung der Zerstörung der Städte als wichtige Gemeinsamkeit. Erste Vorschläge für Kooperationen in den Jahren 1968 und 1969 waren unter anderem eine Ausstellung über die Werktätigen Dresdens in Skopje und ein Informationsaustausch von Architekten und Bauingenieuren in Dresden über Stadtplanung und Bauwesen. Die Stadt am Fluss Vardar war die vierte Partnerstadt Dresdens. Eine Erneuerung der Vereinbarungen erfolgte im Jahr 1995. Nach wie vor sind Städtepartnerschaften eine wichtige Grundlage dafür, andere Kulturen kennen zu lernen und Freundschaften zu schließen. Interessierte können im Internet oder unter der E-Mail-Adresse europa@dresden.de weitere Informationen über die Dresdner Partnerstädte erhalten.
Johannes Wendt
April 2017
Die Abendzeitung - ein Dresdner Unterhaltungsblatt des 19. Jahrhunderts
Vor 200 Jahren, am 1. Januar 1817, erschien die erste Ausgabe der „Abendzeitung“ in Dresden. Die Vorankündigung dazu „An die verehrten Einwohner von Dresden“ vom Dezember 1816 wirbt für ein Unterhaltungsblatt, das fern von Politik und „strengwissenschaftlichen Belehrungen“ dazu beitragen möchte, „mit guten Gedanken das Tagewerk zu beschließen“. Der Abend solle nicht mit Trübsal, sondern heiter und freundlich ausklingen, „kurz einem milden Sommerabende gleich seyn“. Die Begründer der „Abendzeitung“ waren Johann Christoph Arnhold als Verleger sowie Karl Gottfried Theodor Winkler und Friedrich Kind als Herausgeber. Unter dem Pseudonym Theodor Hell hinterließ Winkler zahlreiche Spuren in Dresden. Er war unter anderem beim Stadtgericht, im Geheimen Archiv, an der Kunstakademie sowie am Hoftheater tätig und engagierte sich in mehreren Vereinen. 1824 wurden ihm der Titel eines Sächsischen Hofrates und 1851 die Ehrenbürgerwürde von Dresden verliehen. Theodor Hell verfügte über umfangreiche Sprachkenntnisse und übersetzte ausländische Dramen und Operntexte für die deutsche Bühne. Er verfasste auch selbst Gedichte, Erzählungen und Komödien und gab mehrere Taschenbücher heraus. Sein „Dramatisches Vergißmeinnicht“ ist in der Bibliothek des Stadtarchivs vorhanden. Viele Beiträge der Abendzeitung stammen aus der Feder von Theodor Hell, so auch das Gedicht „Häusliches Gespräch“ auf der Titelseite der ersten Ausgabe. Darin bewirbt er die Zeitung als gemeinsame Feierabendlektüre für „sie“ und „ihn“. Die Abendzeitung erschien an sechs Wochentagen. Auf vier Seiten wurden Gedichte, Kurz- und Fortsetzungserzählungen, Rezensionen sowie Kunst- und Theaternachrichten aus dem In- und Ausland präsentiert.
Viele der Verfasser waren, wie Theodor Hell selbst, Mitglieder des „Dresdner Liederkreises“. Kritiker, wie Hermann Anders Krüger, warfen der Zeitung „Pseudoromantik“ und Mittelmäßigkeit vor. Die Allgemeine Deutsche Biographie würdigt hingegen ihre „literarische Bedeutsamkeit als erstes belletristisches Blatt der Restaurationszeit“ (Band 11, S. 694, Leipzig 1880). Neben den regelmäßig enthaltenen „Correspondenz-Nachrichten“ über Theateraufführungen und Kulturereignisse sind historische Beiträge besonders interessant. Sie beschreiben beispielsweise die Geschichte der Kreuzkirche in Dresden, die Fuchsjagt in England oder den Lachsfang in Schottland. Im Stadtarchiv ist die Abendzeitung von 1817 bis 1841 fast lückenlos überliefert. Aus der Redaktionszeit von Hells Nachfolger, Robert Schmieder, sind nur der Jahrgang 1848 und einzelne Ausgaben vorhanden.
Christine Stade
März 2017
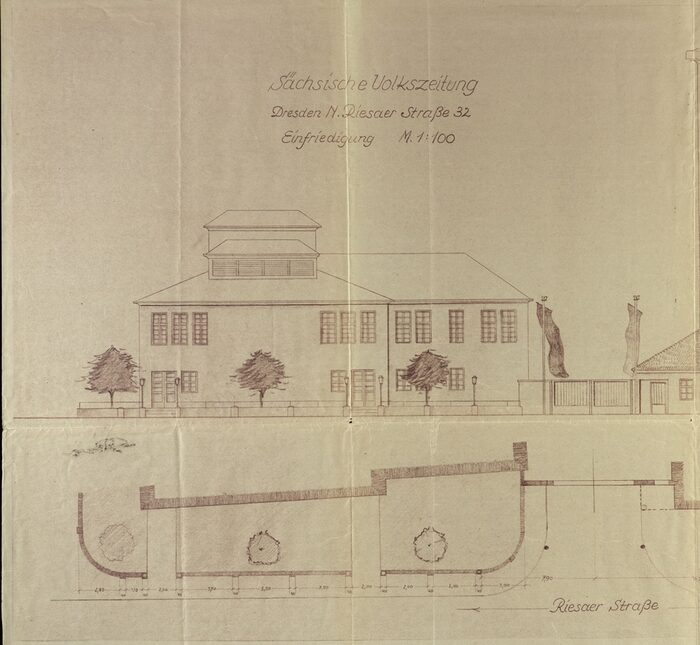
Vom Hochbunker zum Zentralwerk für Kunst und Kultur
Im November 1945 beantragte die „Druckerei Sächsische Volkszeitung“ bei dem Amt für Wiederaufbau eine „schnellste Einrichtung des Druckreibetriebes“. Laut Antrag waren dafür aufwendige Umbaumaßnahmen notwendig. Es handelte sich dabei um die Industrieanlage „Goehle-Werk“ der Zeiss Ikon AG im Stadtteil Pieschen, in der bis zum Kriegsende Sprengkapseln und Zünder, insbesondere durch Zwangsarbeiter angefertigt wurden. Die Bebauung des Areals zwischen Großenhainer Straße, Heidestraße und Riesaer Straße erfolgte, ausgenommen von der Nähmaschinenfabrik der Firma „Clemens Müller“ (später Werk B), zwischen 1938 und 1940. Bauliche Veränderungen, insbesondere für die neu zu errichtenden Sprengstofflager sind noch bis Ende April 1945 nachzuweisen. Die Industrieanlage gehörte zu einem der größeren Rüstungsbetriebe in Dresden. Das Produktprofil der Zeiss Ikon AG wurde gegen Ende der dreißiger Jahre wesentlich durch den stark gestiegenen Rüstungsbedarf aller Waffen der Wehrmacht/Reichsmarine bestimmt. Die Namensgebung erfolgte nach Herbert Goehle (1878-1947), Konteradmiral der Kriegsmarine. Bei der Archivalie des Monats handelt es sich um einen Entwurf aus den 1950er Jahren. Abgebildet ist das ehemalige Gemeinschaftshaus des Goehle-Werkes.
Nach einem Lageplan von 1945 bestand der Industriekomplex aus Werk A und Werk B, beide jeweils mit zwei markanten Hochbunkern beziehungsweise Schutztreppenhäuser. Die Treppenhäuser wurden an der Gebäude-Außenseite mit entsprechenden bombensicheren Wand- und Deckenstärken angebaut. Signifikant sind zudem die Abprallverdachungen über den Treppenhausfenstern und Treppenhaustüren sowie die weit hervorgehobenen Aufschlagdecken, die den baulichen Abschluss bilden. Das Werke A ist einschließlich der beiden Hochbunker und des Gemeinschaftshauses den Architekten Emil Högg und Friedrich Rötschke zuzuschreiben. Das zweigeschossige Gemeinschaftshaus (Ecke Heidestra-ße/Riesaer Straße 32) mit dazu gehörigem Keller nutzte die Direktion zum einen als Lagerungsort und zum anderen für die Belegschaft. Dort gab es sowohl Wasch- und Ruheräume als auch eine Arztstation, die eben-falls mit Zimmern für Grünkreuzvergiftete für eine Entgiftung eingerichtet wurde. Im Erdgeschoss standen eine Küche sowie ein großer Saal mit Bühne zur Verfügung. Die im Obergeschoss befindlichen Ränge des großen Saales, ein kleiner Saal, Büroräume und eine Terrasse, sollten ebenfalls für die Belegschaft des Werkes zur Verfügung stehen. In den fünfziger Jahren nutzte die „Sächsische Volkzeitung“ dieses Gebäude als Kulturhaus. Derzeit ist dieser Ort in eine Kulturfabrik umgewandelt. Das Projekt wurde durch den friedrichstadtZentral e.V. initiiert (heute in Zentralwerk e.V. umbenannt), was zur Gründung der Zentralwerk Kultur- und Wohngenossenschaft eG geführt hat. Seit 2016 verbindet das „Zentralwerk“ sowohl im ehemaligen Werk B als auch im Gemeinschaftshaus, Wohnen, Arbeiten, Kunst und Kultur auf einem Gelände.
Annemarie Niering
Februar 2017
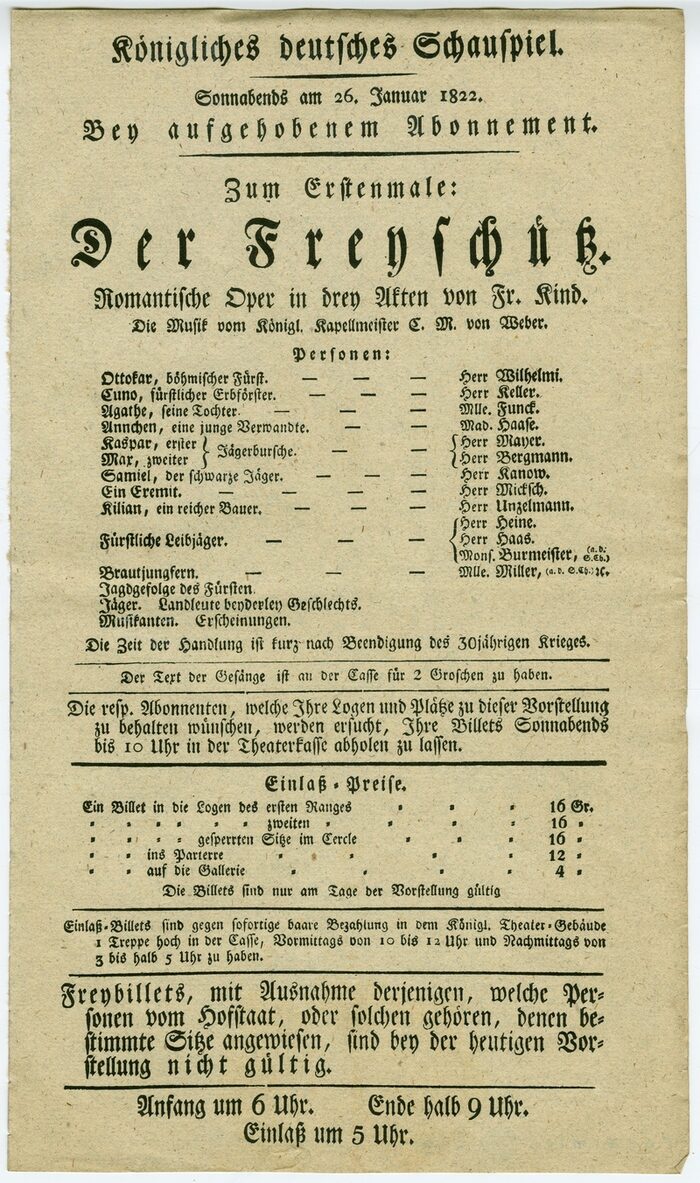
Carl Maria von Weber und die Erstaufführung des „Freischütz“ in Dresden am 26. Januar 1822
Am 29. Januar 1817 veröffentlichte die „Abend-Zeitung auf das Jahr 1817“ einen Artikel von Carl Maria von Weber (1786-1826) mit dem Titel: „An die kunstliebenden Bewohner Dresdens“. Weber, der Tage zuvor als Musikdirektor in Dresden begann, schrieb darin über die bevorstehende Gründung einer deutschen Opernanstalt, es scheint „dem Gedeihen der Sache zuträglich, ja vielleicht notwendig, dass derjenige, dem die Pflege und Leitung des Ganzen derzeit übertragen ist, Art, Weise und Bedingung zu bezeichnen sucht, unter welcher ein solches Unternehmen ins Leben treten kann.“ Der Intendant der Dresdner Hofoper, Heinrich Vitzthum von Eckstädt (1777-1837) sah in Carl Maria von Weber den geeigneten Musiker, für seine Idee neben der bestehenden italienischen Oper eine deutsche Oper zu verwirklichen. Weber erneuerte und veränderte Vieles im Opernbetrieb in Dresden und achtete beim Inszenieren auf die Einheit von Bühnenbild, Kostümen und Darstellungsstil mit Musik und Handlung. Dazu schrieb er bereits 1817: „Schmuck, Glanz und Enthusiasmus werden einer Kunstanstalt nur durch ausgezeichnete hohe Talente verliehen. Diese sind in der ganzen Welt selten. Bewahrt und festgehalten wo sie sind, sind nur die Zeit, und der Segen, der jedem menschlichen Beginnen allein Gedeihen bringen kann, im Stande, diese in der Folge zu verschaffen.“ Durch Webers Wirken wurde Dresden zu einem Zentrum der musikalischen Romantik. Seine Opern trugen zur Durchsetzung der deutschen Oper bei. „Der Freischütz“, uraufgeführt in Berlin am 8. Juni 1821, gehört seit seiner Premiere am 26. Januar 1822 in Dresden besonders eng zur Dresdner Operngeschichte. All das wird auch in der sehr ausführlichen Rezension der Dresdner Erstaufführung vom 26. Januar 1822 des Theaterkritikers Karl August Böttiger (1760-1835) in der „Abend-Zeitung auf das Jahr 1822“ deutlich. Man spürt beim Lesen die Bewunderung für die Musik von Carl Maria von Weber. Sehr genau wird das Zusammenspiel des gesamten Opernensembles gelobt, das Bühnenbild, die Bühnentechnik für die Wolfsschlucht, die zur Ausstattung der Szenen passenden Kostüme werden genau beschrieben. Die Hauptakteure werden namentlich genannt und ihr Gesang sowie ihr Spiel erläutert. Mit dem Freischütz wurde die Oper am 31. August 1944 geschlossen und nach dem Wiederaufbau am 13. Februar 1985 eröffnet.
Gisela Hoppe
Januar 2017
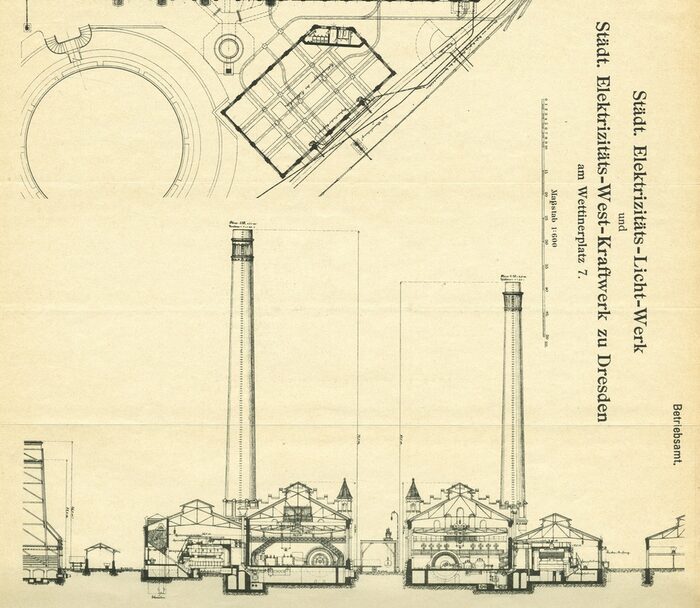
Das Elektrizitätswerk am Wettiner Platz oder die Kunst der städtischen Stromerzeugung
Mit der feierlichen Eröffnung vom Kraftwerk-Mitte am 16 Dezember 2016 erhält Dresden ein neues kulturelles Zentrum inmitten der Stadt. Die Staatsoperette Dresden und das tjg. theater junge generation öffneten an diesem Tag ihre Türen für den Publikumsverkehr in einem architektonisch imposanten Gebäudekomplex. Beide städtischen Einrichtungen können sich im ehemaligen Elektrizitäts-West-Kraftwerk über moderne Spielstätten freuen. In das benachbarte vormalige Licht-Werk ist seit August 2016 schon das Heinrich-Schütz-Konservatorium eingezogen. Anlässlich dieser Eröffnung präsentiert das Stadtarchiv Dresden im Lesesaal eine Planskizze beider Gebäude des Kraftwerks-Mitte. Für fast einhundert Jahre dominierten statt schöner Klänge und schauspielerischer Leistungen auf dem Gelände Lärm, Dampf und Ruß mit Geruchs- und Lärmbelästigungen für die Anwohner. Das Kraftwerk war als städtisches Unternehmen zur Stromerzeugung für den wachsenden Energiebedarf der Unternehmen, der öffentlichen Hand und der privaten Haushalte geplant. Wie die Akten des Stadtarchivs belegen, sollten mit dem im Jahr 1895 erbauten sogenannten Elektrizitäts-Licht-Werk gleichzeitig 15.000 Lampen zu je 16 Kerzen mit Strom versorgt werden.
Einige skeptische Stadtverordnete warnten zwar davor, dass solche Abnahmemengen gar nicht realistisch wären, aber ihre Bedenken wurden sehr schnell ausgeräumt. Noch bevor die Anlagen ans Netz gehen konnten, lag die Zahl, der von den Bewohnern angemeldeten Lampen, schon bei 31.000, also der doppelten Anzahl. Dazu sollten noch 4.000 Lampen in städtischen Gebäuden und 3.360 Straßenleuchten dazukommen. Diesem Mehraufwand wurde planerisch durch den Bau einer zusätzlichen Dampfdynamomaschine Rechnung getragen. Hinweise auf eine öffentliche Einweihungsfeier für das Licht-Werk finden sich in den Akten des Stadtarchivs jedoch nicht. Der 15. Oktober 1895 war laut Bauvertrag der Tag, an dem der Betrieb mit drei Dampf-Dynamomaschinen aufgenommen werden sollte. Allerdings erfolgte die offizielle Inbetriebnahme des Licht-Werkes erst am 28. November 1895. Damit war aber keine durchgehende Stromversorgung gewährleistet, sondern „die Betriebsdauer wird sich auf bestimmte Tagesstunden beschränken [...]“. In den Wochen nach der Inbetriebsetzung konnte von einer kontinuierlichen Stromlieferung nicht die Rede sein. Immer wieder kam es zu technischen Mängeln der Dampfdynamomaschinen, die erst langfristig gelöst wurden. Erst am 22. August 1899 konnte die Betriebsleitung des Elektrizitätswerks erklären: „Abgesehen von einigen Störungen, die durch Reibung von nicht eingelaufenen Gelenken und Bolzen an den Regulatoren verursacht werden, funktionieren alle Maschinen heute gut und sicher“. Um den ständig steigenden Strombedarf zu befriedigen, entschlossen sich die Stadtverordneten im Jahr 1898, dass sogenannte West-Kraftwerk als spiegelbildliches Pendant zum Licht-Werk zu bauen, um somit weitere Privathaushalte sowie die beiden Dresdner Straßenbahn Gesellschaften mit Strom zu versorgen.
Marco Iwanzeck