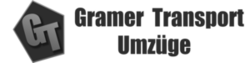|
Landeshauptstadt Dresden - www.dresden.de https://www.dresden.de/de/stadtraum/verkehr/verkehrsplanung/verkehrsentwicklungsplanung/mobilitaetsplan-2035plus.php 11.04.2024 12:53:07 Uhr 25.04.2024 23:48:35 Uhr |
|
Dresdner Mobilitätsplan 2035+
Worum geht es?
Mobil sein ist das Kennzeichen unserer modernen Gesellschaft. Wir sind immer unterwegs, ob beruflich oder privat. Die nationalen Klimaschutzziele sind jedoch nur mit einem konsequenten Wandel unserer Mobilität zu erreichen. Dafür müssen wir Mobilität auch in Dresden ganz neu denken: Wie gestalten wir eine klima- und stadtverträgliche Mobilität der Zukunft? Wie werden sich Digitalisierung und Automatisierung auf unsere Mobilität auswirken? Können wir in einer zunehmend überwärmten Innenstadt öffentlichen Raum so umgestalten, dass wir uns dort auch bei Hitze gern aufhalten? Wie viele Parkplätze werden in Zukunft noch benötigt? Und könnten wir daraus nicht mehr Grünflächen, Parks oder Spielplätze machen? Wie schaffen wir Anreize für eine individuelle Mobilität ohne eigenes Auto? Können wir eine umweltfreundliche Mobilität garantieren, die für alle erreichbar und nicht eine Frage des Geldbeutels ist?
Alles zum Dresdner MOBIplan 2035+
Was ist der Dresdner Mobilitätsplan 2035+?
Warum wird dieses Konzept erarbeitet?
Wie entsteht der Mobilitätsplan 2035+?
Wer arbeitet an dem Konzept mit?
Der wissenschaftliche Fachbeirat
Weitere Informationen
-
Pressemitteilung "Mobil-O-Mat: Mehr 6.300 Menschen planen den Verkehr der Zukunft"
20. März 2024
-
Pressemitteilung "Mobil-O-Mat: Dresdens Verkehr der Zukunft am Bildschirm planen"
5. Februar 2024
-
Pressemitteilung "Dresdner Mobilitätsplan 2035+: Stadtrat bestätigt Leitziele für Mobilität"
22. Dezember 2022
-
Pressemitteilung "Dresdner stimmten über Leitziele für Mobilität der Zukunft ab"
9. April 2022
-
Pressemitteilung "Online-Bürgerbefragung zum Dresdner Mobilitätsplan 2035+ startet"
26. Januar 2022
-
Präsentation zur Pressekonferenz zu den Leitzielen für Mobilität in Dresden
(*.pdf,
4 MB)
26. Januar 2022
-
Pressemitteilung "Mobilität der Zukunft: 25 Bürger für MOBIdialog 2035+ ausgewählt"
14. Juli 2021
-
Pressemitteilung "Dialog zur Mobilität der Zukunft in Dresden"
11. Juni 2021
-
Präsentation zur Auftakt-Pressekonferenz
(*.pdf,
3 MB)
28. April 2021
-
Pressemitteilung "Wie sieht die Mobilität der Zukunft aus?"
28. April 2021